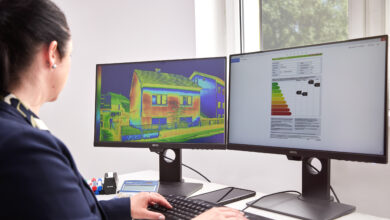Arbeitswelten im Wandel
Flexibilität statt starrer Strukturen, Begegnung statt nur Besprechung: Das Büro der Zukunft ist mehr als ein Arbeitsplatz. Es wird vielmehr zum Möglichkeitsraum für neue Formen des Arbeitens und der Zusammenarbeit. Und schafft damit großes Potenzial für Tischlereibetriebe.
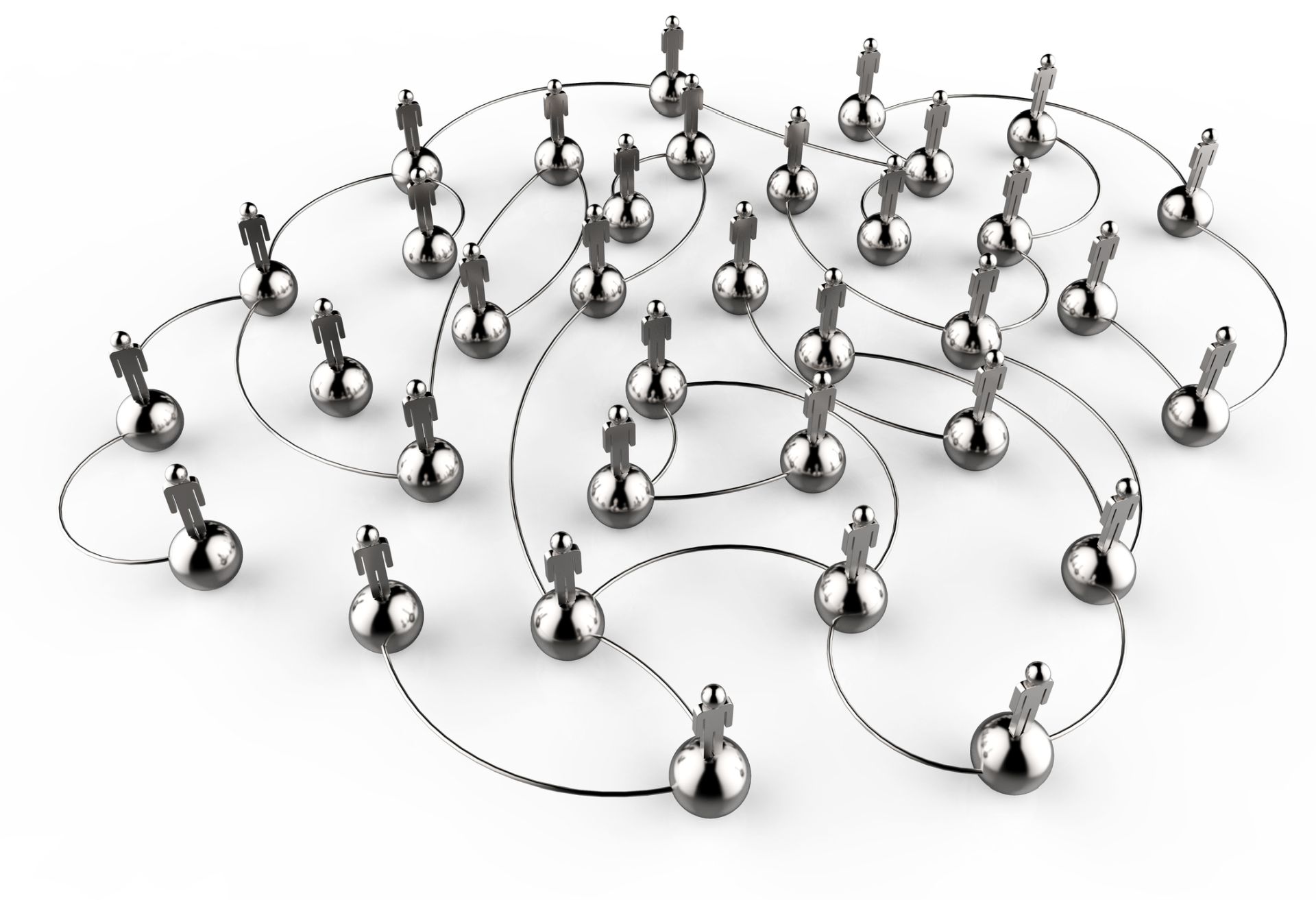
In einer Arbeitswelt, die von hybriden Modellen, digitaler Vernetzung und innovativen Lösungen im Bereich Produktion geprägt ist, verändert sich auch die Rolle des Büros grundlegend. Während früher der eigene Arbeitsplatz der zentrale Dreh- und Angelpunkt war, stehen heute Flexibilität, Zusammenarbeit und Wohlbefinden im Fokus – und das weit über den jeweiligen Schreibtisch hinaus. Büroräumlichkeiten werden zur Bühne für Teamwork und kreativen Austausch – und gleichzeitig zum Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten. Zwischen inspirierendem Design und funktionaler Ausstattung geht es vor allem um eines: Räume, die Menschen verbinden und Potenziale entfalten. Apropos Potenziale: Die gilt es auch für Tischlereibetriebe zu entdecken – schließlich verändern sich Arbeitswelten nicht nur auf Kund*innenseite, sondern auch in den eigenen vier Betriebswänden.
Verschwimmende Grenzen

(C) Schmidhuber Raum GmbH
Ob Werkstatt, Baustelle oder Büro – in Handwerksbetrieben verschwimmen die Grenzen zwischen den Arbeitsorten zunehmend. Kundentermine werden digital vorbereitet, Planungsgespräche finden hybrid statt, und für Projektteams braucht es Raum für Austausch. Zudem holt der Dienstleistungsanteil in Tischlereibetrieben zunehmend gegenüber jenem der Produktion auf – vor allem durch das Fortschreiten der Automatisierung. Damit wächst auch der Anspruch an die Büroflächen: Sie sollen flexibel nutzbar sein, Kommunikation fördern und Rückzug ermöglichen. Wer dabei an Hochglanzlösungen denkt, irrt: Es geht vielmehr um passgenaue Konzepte, die zur Größe und Struktur des Betriebs passen. Ein modular eingerichtetes Büro, das sowohl spontane Teamrunden als auch ruhige Einzelarbeit zulässt, ist heute wichtiger denn je. Offene Flächen für kurze Abstimmungen, funktionale Rückzugsbereiche und eine Ausstattung, die mobiles Arbeiten unterstützt, sind kein Luxus mehr, sondern werden zunehmend zum Standard. Gerade in kleineren und mittleren Betrieben, in denen persönliche Kommunikation einen hohen Stellenwert hat, kann ein klug gestaltetes Büro den Unterschied machen. Es schafft Raum für Begegnung und erleichtert die Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg. Wer dabei bewusst auf die eigenen Bedürfnisse schaut und die Mitarbeitenden einbindet, legt die Basis für ein modernes Büro, das den Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
Begegnungszone
„Das Büro ist aus unserer Sicht zu einem Raum geworden, wo man sich wohl fühlt und gerne mit Kolleg*innen Zeit verbringt“, so Johannes Spatzenegger, Geschäftsführer der Tischlerei Schmidhuber. „Vor nicht allzu langer Zeit waren die schönen Büros der Geschäftsleitung vorbehalten – diese Ära sollte längst der Vergangenheit angehören.“ Schließlich sind Büroräumlichkeiten mittlerweile ein wesentlicher Teil des „Employer Brandings“. „Heutzutage steht die Frage im Fokus: ‚Wie wollen meine Mitarbeitenden arbeiten?‘ Es braucht modulare und vielseitige Arbeitsräume – und es liegt in den Händen der Geschäftsleitung, diese zu schaffen.“ Genau das hat der Betrieb in Seekirchen am Wallersee selbst umgesetzt: „Wir arbeiten in agilen Teams gemeinsam an unseren Projekten – genau das wird auch in unserer Büroarchitektur sichtbar. Die Gestaltung der Räume spiegelt unsere Firmenphilosophie wider.“ Hier arbeitet das heterogene Team in Kojen, schlaue Trennwandsysteme schaffen bei Bedarf Ruhe und Rückzugsorte.

Johannes Seidl,
GF Tischlerei Seidl. (C) Miss Freckles Photography
„Teststation“ Küche
Die altbekannte „Teeküche“ ist in der Tischlerei Schmidhuber eine wunderschöne Küche, die nicht nur von Mitarbeiter*innen genutzt wird, sondern auch einmal pro Monat von einem Profi bespielt wird. Damit wird das eigene Büro auch zum Schauraum: „Wir probieren auch ganz bewusst Neues aus, um die Umsetzung für unsere Kund*innen zu erproben.“ In Sachen Automatisierung der Produktion sei der Betrieb seiner Zeit voraus: „Wir haben schon früh auf Automatisierung gesetzt und haben daraus viel gelernt – auch was die Gestaltung unserer Büros betrifft“, so Schmidhuber weiter. Und er ist darüber hinaus überzeugt: „Auch im bei den Dienstleistungen wird der Automatisierungsgrad steigen.“ Die Entwicklungen im Bereich flexibler Arbeitsräume seien für Tischlereibetriebe eine riesige Chance: Büromöbel müssen in Zukunft deutlich funktioneller und vielseitiger werden – auch, weil der Homeofficeanteil aktuell so hoch wie nie ist und Wohnraum immer knapper wird. Darüber hinaus sei die Zeit von nüchternen Großraumbüros längst vorbei. „Individuelle Lösungen für Kund*innen sind gefragt, ganz egal, ob im Privat- oder Objektbereich – und hier liegt die große Chance für die herstellenden Betriebe.“
Klappt reibungslos
Genau in diese Kerbe schlägt die Tischlerei Seidl im salzburgischen Kuchl. Mit dem Roomflapper hat Johannes Seidl ein Möbel entworfen, das im Handumdrehen vom Bett in einen Schreibtisch umgewandelt werden kann. Die variable Homeoffice-Lösung, die auch mit dem Salzburger Handwerkspreis ausgezeichnet wurde, vereint auf kleinem Raum Wohnen und Arbeiten. In der Nacht ein komfortables Bett, wird der Roomflapper untertags zum Büro, in dem beinahe alles Platz findet – vom Laptop bis zum Drucker bis zu einer Höhe von 33 Zentimetern. Sehen lassen kann sich dabei nicht nur der Liegekomfort des Bettes, auch das Büro kann über Nacht quasi „liegen bleiben“ – einfach Bettteil herunterklappen und der Arbeitstag hat ein Ende. Die Rückseite des Lattenrosts ist mit einer Korkschicht versehen, die als Schreibtisch-Pinnwand verwendet werden kann – so geht garantiert keine Idee verloren. Darüber hinaus ist der Roomflapper auch als Doppelbettlösung erhältlich und kann durch eine Schrankwand oder Nachtkästchen erweitert werden. Individuelle Lösungen für seine Kund*innen zu finden macht Johannes Seidl besonders viel Freude: „Ich bin ein Tüftler und entwickle gerne Ideen, um Arbeits- und Wohnräume noch effizienter zu gestalten.“

Neue Realitäten
Aus Seidls Sicht wird sich sowohl in den Büros der Kund*innen als auch in jenen der Tischlereibetriebe in Zukunft einiges ändern – dort und da sind flexible Lösungen gefragt. „In Zeiten, wo Wohnraum immer teurer und kleiner wird, sind flexible Arbeitslösungen in den eigenen vier Wänden besonders gefragt.“ Im eigenen Betrieb wurden die Büroräumlichkeiten ebenfalls erweitert: Dort ist jetzt genügend Platz, um Kundinnen und Kunden auch mittels Virtual-Reality-Brille die persönliche Vorstellung vom neuen Raumgefühl zu vermitteln. Zusätzlich bietet ein großer Präsentationstisch viel Platz, um Materialien oder Muster zeigen zu können. „Bei uns hat in den letzten Jahren der Dienstleistungs- und Servicecharakter deutlich zugenommen – und dafür braucht es einfach die passenden Räumlichkeiten.“
Büro im Wandel
„Das Büro hat eine absolute Bedeutung, die sich stark gewandelt hat“, skizziert Trendforscher Franz Kühmayer. Früher als etwas Selbstverständliches angesehen, ist es inzwischen durch die große Disruption der Corona-Pandemie zu einem Ort geworden, dessen Grenzen sich verschoben haben. „Neben der Ortsgrenze durch Homeofficeregelungen hat sich auch die Grenze der Technologie geändert“, so Kühmayer. Das Gespräch, das im Rahmen des Artikels stattfindet, zeigt gut auf, inwiefern: Durch Technologieplattformen wird so ein Interview zwischen Montreal und Wien leicht möglich. Während der Berater in seiner nordamerikanischen Dependance weilt, erzählt er über neue Arbeitswelten. „Hybrid ist das neue ‚Normal‘. Und dafür braucht es die passenden Werkzeuge“, so Kühmayer. Auch die Zeitgrenze habe sich verschoben „Wir stellen fest, dass ein Normalarbeitsverhältnis im Sinne einer 40-Stunden-Woche im Rückzug ist – mittlerweile arbeitet fast jede dritte Person in Teilzeit.“
Analoger Anker
Mit diesen Entwicklungen ändert sich laut dem Trendforscher auch die Natur des Büros. Es brauche zum einen Räume für formale Zusammenarbeit, wie Besprechungen und Meetings; aber auch Räume für informelle Begegnungen, die sich mittlerweile deutlich von der schon erwähnten Tee- bzw. Kaffeeküche unterscheiden. „Heute werden Atmosphären geschaffen, die informelle Begegnungen möglich machen.“ „Casual collision“ nennt der Berater dieses Phänomen: Die zufällige Begegnung, die einen Raum braucht und enorm wichtig ist für die Zusammenarbeit. Ein gutes Beispiel ist der Technologieriese SAP, dessen Neugestaltung der Büroräumlichkeiten aus Kühmayers Beratungsfeder stammt. „Viele dachten, das Büro eines Digitalisierungsgiganten muss aussehen wie das Cockpit von Raumschiff Enterprise“, lacht er. „Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Wir haben im Rahmen der Umgestaltung viele natürliche Elemente integriert. Damit wird das Büro zum analogen Anker in einer digitalen Welt.“
Kreative Schaltzentralen
Darüber hinaus gibt es laut Franz Kühmayer auch eine qualitative Veränderung: „Lange Zeit war Wissensarbeit eine quantitative Arbeit – Akten wurden abgelegt, Unterlagen ausgedruckt, Papiere sortiert. Mittlerweile hat sich Wissensarbeit zur kreativen Leistung entwickelt.“ Während früher das Büro eine Art „Gedächtnis“ mit einer physischen Ablage war, ist es heute ein anderer Ort: „Der Erfolg der Zukunft ist nicht von der Gedächtnisleistung abhängig, sondern von der Innovationsleistung.“ Und diese braucht Räume zur Entwicklung, die eben jene Kreativität und Innovation fördern – ganz abseits von nüchterner Büroumgebung. „Wer seine grauen Zellen anstrengt, sollte nicht in einer grauen Zelle sitzen“, bringt es Kühmayer auf den Punkt. Es brauche Räume zum Lernen, für die Zusammenarbeit, für konzentriertes Alleine-Arbeiten, für Begegnung. „Büros sind zu Kulturorten geworden. Wenn dieser Raum gut umgesetzt ist, kann ich nicht nur nutzenbringend arbeiten, sondern auch die Unternehmenskultur erleben und spüren. Denn diese erkennt man unmittelbar an der Gestaltung der Büros .“
Gerade für Tischlereibetriebe sieht Kühmayer hier großes Potenzial: „Tischler*innen sind Gestalter*innen dieser Räume und können ihre Kund*innen unterstützen, genau diese Kulturorte zu schaffen.“ Auch die Kund*innen wollen anders gesehen werden und erwarten sich immer mehr Erlebnischarakter, wenn sie in den Betrieben beraten werden. Ein Beispiel sind für Kühmayer Winzereibetriebe: Dort werden in vielen Fällen Marke und Qualität des Weins erlebbar – ein Kulturerlebnis, das früher oft im muffigen Verkostungskeller untergegangen ist. Auch auf Produktebene ergeben sich Möglichkeiten: „Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeitenden immer mehr in der Ausstattung ihrer Homeoffice-Bereiche – für die Tischler*innen bietet sich hier ein großer Markt.“ ■