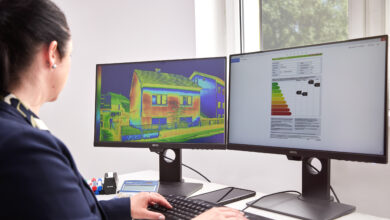Sind Bäume Wegwerfprodukte der Architektur?
Bäume in Städten werden durchschnittlich nur 25 Jahre alt – und das, obwohl sie Kühlung, Biodiversität und Geschichte schenken. Kristina Pujkilovic von der TU München erklärt im Gespräch die Ideen der Baubotanik – und warum ein neuer Umgang mit Bäumen in der Architektur nötig ist.

Kristina Pujkilovic forscht und lehrt an der TU München zu grünen Technologien in der Landschaftsarchitektur und ist gemeinsam mit Ferdinand Ludwig für die Ausstellung „Trees Time Architecture“ in München als Kuratorin verantwortlich. Wir haben mit ihr das folgende Gespräch geführt.
Architektur und Bau FORUM: In der Ausstellung „Trees Time Architecture“ geht es um das komplexe Verhältnis von Bäumen und gebauter Umwelt. Die Bäume werden zu Protagonisten in der Architektur, auch in der „Baubotanik“. Es geht hier um ein radikales Umdenken.
Kristina Pujkilovic: Vor allem in urbanen Räumen rückt der Baum oft als Dekorationselement in den

Hintergrund, wird romantisiert und idealisiert. Bäume nehmen aber eine ganz andere Dimension ein. Der Baum ist 350 Millionen Jahre alt und hat in dieser Zeit CO₂ eingelagert. So ist Kohle entstanden, die wir als fossilen Baum seit der Industrialisierung innerhalb kürzester Zeit verfeuern. Und Baum bedeutet nicht nur CO2-Speicher oder fossiler Baum, sondern auch ein kontroverses politisches Element, zum Beispiel bei den Protestbewegungen im Hambacher Forst.
Der Baum ist in unseren Städten dringend nötig, für Kühlung, Schattenwirkung und Biodiversität. Ein Baum steht im Stadtgebiet im Durchschnitt etwa 25 Jahre lang. Er muss weg, wenn neu gebaut wird, oder wenn auf Tiefgaragen gepflanzt wird, die nach 30 Jahren erneuert werden. Ein Baum könnte weitaus älter werden: 200, 300, 500 bis zu 1000 Jahre. Er steht in seinem Teenageralter in unseren Städten. Die zeitliche Dimension, die dahintersteht, wollen wir aufzeigen.

Ein Teil der Ausstellung befasst sich mit der Disziplin „Baubotanik“. Könnten Sie dieses Konzept ein wenig erläutern?
Baubotanik beschäftigt sich mit der lebenden Architektur, Baum und Architektur in einem Nebeneinander, in einem Innenhof, auf einem Gebäude, in ein Gebäude integriert. Dann kommen wir zur lebenden Architektur, zu Baum-als-Architektur. In der Baubotanik werden zwei individuelle Bäume durch technische und mechanische Mittel miteinander verwachsen. In dieser Transformation werden aus zwei Bäumen einer, Nährstoffe und Wasserhaushalt werden geteilt. Der Baum wird leistungsstärker und kann in Form dieser Verwachsung als statisches Mittel eingesetzt werden, indem zum Beispiel Brücken- oder Trägerelemente eingewachsen werden. Das ergibt eine Symbiose, und die lebende Architektur wächst weiter, befindet sich in einem ständigen Prozess. Man muss das Ganze pflegen. Es gibt keinen Zeitpunkt des Abgeschlossenen. Das ist uns wichtig, weil wir davon lernen wollen: Was bedeutet es, wenn man sich um Architektur kümmern muss, wenn man sich ihr zuwenden muss? Bei konventioneller Architektur ist es ja nicht anders: Wenn ein Gebäude fertig gebaut ist, braucht es weiterhin Pflege und Zuwendung, um es zu erhalten. So können Gebäude ein Alter von 200 Jahren erreichen, und wir können anders mit den Ressourcen umgehen.

Bäume werden nicht als natürliche Komponenten herangezogen, so wie wir das vielleicht ansehen, sondern als reines Produkt.
Kristina Pujkilovic
Wenn mit lebenden Bäumen gebaut wird, ist jedoch nicht vorhersehbar, wie sie genau wachsen. Das ist ein großer Unterschied zu einem statischen Gebäude. Den Baum kann man nicht als Konstante berechnen. Es geht um ein anderes Weltbild, wenn man mit Komponenten arbeitet, die sich verändern, die in Bewegung sind und ein dynamisches Element in das Ganze hineinbringen. Wie kann man so ein Umdenken in der Öffentlichkeit verankern und klarmachen, dass eine andere Sichtweise notwendig ist?
Es geht um das Unvorhersehbare. Man kann nicht abschätzen, was mit einem lebenden Bauwerk geschieht. Doch wenn wir ehrlich sind, ist das mit jedem anderen Element in unserem Leben genau so. Wir können sehr wenig vorhersehen. Es gibt immer die Komponente, dass etwas nicht bis zum Ende planbar ist. Wenn man mit einem Baum plant, versucht man zumindest, ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. In Forschung und Lehre fertigen wir Diagramme und Prognosen an, was mit diesem Entwurf, diesem Bauwerk in 50, 100, 200 Jahren passieren könnte. Wir antizipieren, was sein könnte. Wir wissen nicht, was mit unseren Städten in 200 Jahren geschehen wird. Eine interessante Grafik in der Ausstellung zeigt einen Baum, der 200 Jahre alt ist und im Gegensatz dazu die Stadtentwicklung, die 200 Jahre alt ist. Was muss passieren, damit Bäume dieses Alter erreichen können?
Bei einem Projekt in den Niederlanden hat Noel van Doorn, einer der Beiräte der Ausstellung, versucht, Menschen zu finden, die einen Vertrag unterschreiben, der einen Standort für einen Baum für 100 Jahre garantiert. Er hat niemanden gefunden.

Es gibt in Wien die berühmte Platane, unter der Mozart angeblich schon gesessen hat. Man sieht einerseits einen gewissen Kult um alte Bäume, andererseits haben die Bäume rasch ausgedient. 25 Jahre – sind Bäume ein Wegwerfprodukt?
Das ist ein Durchschnittsalter. Wir haben Bäume im Stadtraum, die weitaus älter sind, aber nicht die Mehrzahl. In einer Installation vor dem Museum, das wir Baumlager nennen, thematisieren wir den Baum als Produkt. Wir zeigen das Baumschulverfahren und wie wir mit Bäumen in Planung, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Architektur umgehen. Bäume werden nicht als natürliche Komponenten herangezogen, so wie wir das vielleicht ansehen, sondern als reines Produkt.
Ein Baum in der Baumschule ist höchst technologisiert. Jeder Ast wächst genau an der Stelle, wo er wachsen soll. Nährstoffe und Wasser sind genauestens dosiert. Es ist eine Maschinerie auf riesigen Flächen, die Bäume heranzieht, die als Produkt geordert und dann über weite Strecken mit Schwerlastern an den Ort gefahren werden, wo man sie pflanzt. Man nimmt sich nicht die Zeit, 30 Jahre zu warten, bis ein Baum so groß ist, um eine Schattenfunktion einzunehmen.
Dazu ein interessantes Beispiel: Der Architekt Sörensen aus Dänemark ging an die Planung eines Wohninnenhofs für eine Mehrfamilienwohnanlage radikal heran. Er bestellte keine Bäume, sondern ließ viele Eicheln aussäen. Denn diese Zeit müssten wir uns nehmen, bis wir den Hof begrünt haben. Meist ist dafür keine Zeit, deswegen erkaufen wir sie uns.
So wie im Film „Taming the Garden“ von Salomé Yashi, der auch in der Ausstellung präsentiert wird. Darin geht es um einen wohlhabenden Mann, der jahrhundertealte Bäume aus ganz Georgien entwurzeln lässt, um sie in seinem Park zu präsentieren.
Statt selbst zu warten, „kauft“ er sich Zeit – ein Ausdruck von Macht und Geltungsbedürfnis. Unzählige junge Bäume wurden gefällt, um Straßen für den Transport der riesigen Wurzelballen bis zum Wasser zu bauen, wo sie verschifft, und in seinen botanischen Garten verpflanzt wurden. Viele der transplantierten Bäume überlebten den Umzug nicht. Erst später wurde vielen Menschen die Tragik bewusst und sie erkannten, was sie verkauft hatten. Ein Baum, der über Generationen Teil des eigenen Lebensraums war, verschwand plötzlich – mitsamt seiner Geschichte und emotionalen Bedeutung. Das zeigt, wie wenig wir oft den wahren Wert alter Bäume erkennen.

Sie betonen, wie wichtig es ist, Bäume als Lebewesen zu begreifen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür sind die „Living Bridges“ in Nordindien: Brücken aus Baumwurzeln, die über Jahrzehnte hinweg wachsen.
Ich war selbst letzten November vor Ort und habe einen Film über die Brücken gedreht. Der Bau dauert 30 bis 40 Jahre – so lange, dass die Erbauer selbst sie fast nie nutzen können. Man baut für nachfolgende Generationen. Dieses selbstlose, generationenübergreifende Denken ist ein zentraler Aspekt der Khasi-Kultur, die auf einem matrilinearen System beruht.
Zudem hat der Ficusbaum auch einen spirituellen Wert, weswegen Brücken, Bäume, Wälder und diese lebende Architektur geschützt sind. Große Flächen unberührter Natur bleiben so als „Sacred Forests“ unter dem Schutz der Gemeinschaft. Man braucht Erlaubnis, um den Wald zu betreten, und es ist strengstens verboten, etwas zurückzulassen oder mitzunehmen – nicht einmal einen Stein oder ein Blatt.
Von so einem Naturschutz auf höchstem Niveau können wir lernen – und uns fragen, warum wir nicht ähnlich mit unseren Wäldern umgehen. In meinen Seminaren frage ich oft nach einem Baum, der im Leben der Studierenden bedeutsam war – meist ist es einer aus der Kindheit.

Im Erwachsenenalter kennt kaum jemand noch einen Baum, zu dem er heute eine Verbindung hat. Warum eigentlich?
Vielleicht ist das eigentliche Problem ein fehlendes gesellschaftliches Bewusstsein. Oft merken wir erst, wie wichtig ein Baum ist, wenn er fehlt – etwa an heißen, kahlen Straßen. Umgekehrt spüren wir sofort, wie sehr ein großer Baum am Haus zur Kühlung beiträgt. Dieses Verständnis muss wieder wachsen.
Trees, Time, Architecture!
Architekturmuseum der TUM – Pinakothek der Moderne, München
bis 14.09.2025 in der Pinakothek der Moderne
- Kurator*innen: Kristina Pujkilović & Ferdinand Ludwig
- Thema: Bäume als aktive Partner in Architektur und Stadtplanung
- Fokus: „Baubotanik“ – lebende Bäume als tragende Strukturen
- Das Buch zur Ausstellung: hier