Lost Generation
In den vergangenen Jahrzehnten haben zahlreiche wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen großen Einfluss auf das Berufsbild des Architekten genommen. Arbeitsweisen änderten sich, Regulierungen fielen aus, die Auftraggeberseite wandelte sich. Das Resultat: eine Generation von Architekten, die dazu gezwungen wird, sich auf einem instabilen Markt selbstständig zu machen. Diese Situation birgt sowohl das Risiko als auch die Chance auf einen Wandel des Berufsbilds.
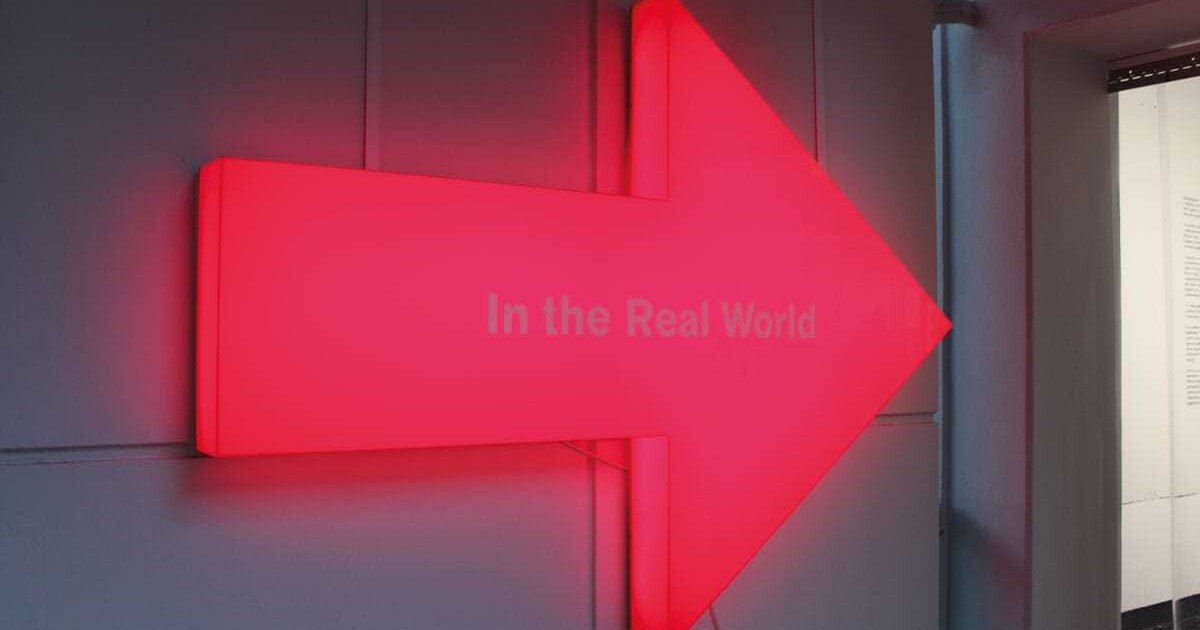
Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 1995 und die Einführung des Euro 2002 haben strukturbedingt für die Architekten vor allem im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit und Honorierung Auswirkungen.
WAS HAT SICH GEÄNDERT?
Die Veränderung ergab sich aus der Teilnahme an den Maastricht-Kriterien, aus der Freizügigkeit bei der Wahl des Arbeitsplatzes, der Freiheit der Niederlassung, der Freiheit des Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehrs, der Dynamisierung der Handelsbeziehungen und der Übernahme des EU-Rechtsbestands. Zudem erreichte das digitale Zeitalter bzw. die digitale Revolution Mitte der Neunzigerjahre auch die bisher hierarchisch aufgebauten Architekturbüros in Österreich. Die Digitalisierung der Informations- und Kommunikationsprozesse in den Planungsabläufen führte u. a. zu einem Wandel der tradierten Bürostrukturen. Es musste in Soft- und Hardware investiert werden, Zeichner wurden spezialisierter, die Produktion wurde schneller. Die Verbesserung der Kommunikation allein durch die Möglichkeit, Pläne digital zu versenden, führte zu einer Erhöhung der Plananpassungen und Umplanungen im laufenden Planungsprozess.
Bis dahin reüssierten die etablierten Architekten bis auf wenige Ausnahmen unter ihrem eigenen Namen. Die Auftragslage war vergleichsweise stabil und die öffentliche Hand ein zuverlässiger Auftraggeber. So manche Gemeinde hatte „ihren“ Architekten, sowohl für die Raumplanung als auch für die Objektplanung. Neben dem eigenen Background und den persönlichen Netzwerken dienten vorwiegend Wettbewerbe zur Generierung von Projekten.
Mit der Gebührenordnung für Architekten (GOA 1972 und 1999) und der Honorarordnung für Architekten (HOA 2002) waren das Leistungsbild und vor allem die Honorarberechnung nach Schwierigkeitsgrad entsprechend den unterschiedlichen Bauaufgaben und deren Größe klar definiert. Der Markt war geregelt und überschaubar, und die Kollegenschaft trat mehr oder weniger solidarisch auf. So konnten mittlere bis große Bürostrukturen entstehen. Als Student fand man einen Job in einem Architekturbüro und konnte im Angestelltenverhältnis oder mit Werkvertrag adäquat verdienen.
Die folgende Architektengeneration, die rund um die Jahrtausendwende ihre Büros eröffnete, war mit den digitalen Medien bereits bestens vertraut. Sie verfügte über reichlich Büroerfahrung und begann mit neuen Büroformen und teilweise innovativen Konzepten als „Boy- and Girlgroups“ unter Namen wie Gaupenraub, Querkraft, LOVE, Balloon, Nonconform, Innocad usw. Diese Büros ersparten sich häufig traditionelle, hierarchische Bürostrukturen und besetzten alle Positionen selbst. Es waren Gruppen junger Architekten, die selbstausbeuterisch 24 Stunden am Tag arbeiteten und alle Aufgaben selbst übernahmen. Kommunikative und technische Möglichkeiten kamen ihnen diesbezüglich sehr entgegen. Die Kommunikation wurde mobil, Arbeitsabläufe, die vor den Neunzigerjahren noch mehrere Stunden beanspruchten, ließen sich nun in einem Bruchteil der Zeit erledigen. Den „Boy- and Girlgroups“ gelang es schnell, sich zu etablieren, und sie profitierten von ihren optimierten Arbeitsweisen.
FREIE MARKTWIRTSCHAFT
Ende 2006 wurde die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten unter Klags- und Strafdrohung von der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde aufgrund des EU-konformen Kartellgesetzes 2005 zur Aufhebung der HOA gezwungen. Die darauffolgende HIA (Honorar Information Architektur 2008 und 2010), basierend auf einer Aufwandsstundenrechnung, entspricht zwar den kartellrechtlichen Vorgaben, wurde aber weder von Architekten noch von den öffentlichen Auftraggebern wirklich angenommen. Deshalb wurde 2014 die nichtverbindliche LM.VM als Kalkulationshilfe auf Basis von Richtwerten und Referenzkosten entwickelt. Die Kammer darf kartellrechtlich nicht in die freie Kalkulation von Angeboten eingreifen. Derzeit kann sie lediglich mit den öffentlichen Auftraggebern verbindliche Honorarvereinbarungen treffen.
Die Solidarität in der Branche war nicht mehr gegeben, und die Honorarsituation begann durch Billigbieter zu entgleisen. Ausgetragen wurde das Preisdumping zuletzt auf dem Rücken der Studenten und Uniabgänger, die teilweise gratis und mit Werkvertrag zu geringsten Stundensätzen in den Architekturbüros arbeiteten und damit ins Prekariat abrutschten.
STUDIENAUSBILDUNG
Der Markt schien bis um die Jahrtausendwende so stabil, dass seit den Achtzigerjahren die Anzahl der Architekturstudenten und -absolventen kontinuierlich, auch bedingt durch die EU-Marktöffnung, anstieg. Es drängten vor allem deutsche Numerus-Clausus-Flüchtlinge an unsere Universitäten.
Der Bologna-Prozess 1999 mit den Bachelor- und Masterstudienplänen läutete die europaweite Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen, die Verkürzung der Studienzeiten sowie die internationale Mobilität der Studierenden ein und zielte auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ab. Die einhergehende „Verschulung“ der Universität hatte neben der Erhöhung der Absolventenzahlen auch eine Entfremdung vom Architekturmarkt zur Folge. Arbeiten während des Studiums wird durch den steigenden Druck durch die seit 2002 andauernde Studiengebührendebatte zum Auslaufmodell. Auch die Universitäten wurden durch das Universitätsgesetz 2002 und die „Privatisierung“ zu einer Institution öffentlichen Rechts in einen internationalen Wettbewerb getrieben und müssen seither wirtschaftlicher agieren. Im Studienjahr 1999/2000 schlossen erstmals mehr als 500 Architekturabsolventen österreichweit ab. Die ersten Masterstudenten wurden 2005/06 fertig. Dabei fallen die Absolventen der Fachhochschulen mit rund 20 bis 36 Studenten pro Jahr seit 2006/07 kaum ins Gewicht (Statistik Austria). Bis 2014 ging die Schere aus zurückgehenden Auftragszahlen, steigender Arbeitslosigkeit und gegengleich steigenden Absolventenzahlen weiter auf. Der bisherige Höhepunkt dürfte mit 2014 erreicht werden, weil mit dem Auslaufen der Studienpläne des Diplomstudiums allein an den TUs Graz und Wien bereits 532 Absolventen, und das trotz eingebrochener Auftragssituation, abgeschlossen haben.
FREIE BERUFE VERSUS DIENSTLEISTUNG
Spätestens seit der Wirtschaftskrise der Jahre 2007/08 befindet sich das Berufsfeld der Architekten europaweit im Wandel. Zwischen 2008 und 2010 war ein Rückgang der Baukonjunktur von rund 13 Prozent beobachtbar (ACE, Architects’ Council of Europe, Sector Study 2012). Die öffentliche Hand war gezwungen zu sparen und fiel als Auftraggeber aus. Über lange Phasen wurden keine offenen Wettbewerbe mehr ausgelobt. Zwar ließ die zunehmende Kapitalverunsicherung den Immobiliensektor wachsen, jedoch waren größtenteils Kapitalanlegerwohnbauten in schlechter Qualität gefragt – Projekte, in denen Architektur eine lästige Nebenrolle spielt. Diese wirtschaftliche Situation zwingt vor allem junge Architekten, Architekturschaffende und -involvierte, das tradierte Rollenbild des Architekten zu hinterfragen und nach neuen Definitionen für sich zu suchen. Das heutige Schaffensfeld von Architekten ist vor allem seit der Einführung der „Neuen Selbstständigen“ im Sozialversicherungsgesetz 1997 und unter Bedrängnis durch planende Baumeister und technische Zeichenbüros weit gestreut: Es reicht von Architekturjournalismus, Architekturvermittlung, (Möbel-)Design, Visualisierungen, Modellbau bis zu Lehrtätigkeiten an Schulen und Universitäten, um einige aktuelle Beispiele zu nennen. Vielfach sind sie – nach amerikanischem Vorbild – als Patchworker in verschiedenen Berufsfeldern tätig.
Die Debatte um den Berufszugang und seiner Regulierung ist längst eröffnet. Während die Kammer und die ältere Generation eine Abkehr vom Dienstleister und einen verstärkten Schutz des Berufszugangs forcieren, verstehen sich vor allem die Jüngeren vermehrt als Dienstleister. Die Regulierung des Berufszugangs, das Führen der Berufsbezeichnung „Architekt“, das Handeln im öffentlichen Interesse, die Einnahme einer bedeutsamen gesellschaftlichen Rolle sowie die Honorierung zeichnet die „freien Berufe“ aus, zu denen auch Notare, Rechtsanwälte und Ärzte gehören und deren qualitätsvolle Arbeit unabhängig von der freien Marktwirtschaft im Sinne der Bevölkerung gesichert werden soll.
WAS WIRD SICH NOCH ÄNDERN?
Seit dem EU-Beitritt versuchten bereits verstärkt Architekten aus benachbarten EU-Ländern nach Österreich zu drängen. Dazu wurde bereits 2005 die Richtlinie der EU über die „Anerkennung von Berufsqualifikation“ (BARL-Richtlinie 2005/36/EG) erlassen, die mit Jänner 2014 in Kraft getreten und innerhalb von zwei Jahren, also bis Jänner 2016, in das nationale Recht der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten umzusetzen ist. Die Berufsaussichten für angehende Architekten sind düster. Hatte man bis in die Neunzigerjahre die Wahl, sich selbstständig zu machen oder aber in den Systemen der großen Büros in einem Angestelltenverhältnis zu verbleiben, so besteht in der Zwischenzeit annähernd der Zwang zur Selbstständigkeit. Entscheidet man sich dazu, in diesem Beruf nichtselbstständig zu arbeiten, muss man damit rechnen, projektbezogen den Arbeitgeber zu wechseln und mit zunehmenden Honorarvorstellungen in der Arbeitslosigkeit zu landen. Zudem kommt, dass diese Büros ihr Leistungsbild rapid eingeschränkt haben. Sie befassen sich vor allem mit der Entwurfs- und Einreichplanung, die sie auch mit kostengünstigen Praktikanten bestreiten können, die über Stipendien kofinanziert werden.
Architekten ab 40 werden dadurch entweder zur Berufsflucht oder in die Selbstständigkeit als Architekten gedrängt. Die Neugründung großer und mittelgroßer Büros stellt eine Ausnahme dar – vor allem werden Einpersonenunternehmen gegründet, die sich teils durch Spezialisierung, teils durch Dienstleistungen im Arbeitsumfeld der Architektur (Visualisierungen, Modellbau, Architekturjournalismus, Architekturfotografie) über Wasser halten. Eine Lost Generation ist entstanden, die gefordert ist, den Beruf neu zu definieren und die Bedingungen für das Architekturschaffen neu festzulegen. Diese neue Generation von Einzelkämpfern erkennt derzeit zunehmend das Potenzial aktiven Netzwerkens. Die Rolle der Kammer scheint hingegen zu schwinden. Die Möglichkeit der Honorarregulierung durch die Kammer ist durch die Unverbindlichkeit der gegenwärtigen Vereinbarungen de facto nicht mehr gegeben. Die LM.VM.14 ist der dritte Versuch in Serie, eine Wertsteigerung der Planungstätigkeit zu erzielen. Ob er mit Erfolg gekrönt ist, bleibt fraglich. Die Regelung des Berufszugangs funktioniert auch nur noch in der Theorie. De facto regelt die Kammer nur noch den Kammerzugang und kann durch Anhebung des Niveaus der ZT-Prüfung die Zahl der Ziviltechniker drosseln. Da es rechtlich möglich ist, ein technisches Zeichenbüro sogar als Architekturbüro zu titulieren und zu bewerben, weil nur der Begriff „Architekt“ geschützt ist, scheint die Sicherung des Berufszugangs fraglich.
Es bedarf dringend der aktiven Stärkung des Berufsstands, um zu ermöglichen, dass wieder nachhaltige und zukunftsweisende Architektur geplant werden kann. Es ist höchste Zeit, dass die Politik beginnt hinzuhören, wenn sich die Lost Generation formiert und Forderungen stellt. Für die Kammer ist es die letzte Chance, sich aufzubäumen, die Jungen zu stärken und aufzuholen, was sie in den vergangenen Jahrzehnten verabsäumt hat.
von Martin Brischnik und Petra Kickenweitz



