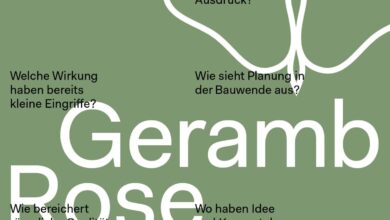Sanierte Mehrzweckhalle mit neuer Ästhetik
Die 1964 erbaute Mehrzweckhalle im deutschen Ingerkingen wurde umfassend saniert, umgebaut und erweitert. Der Erhalt von rund 60 Prozent der ursprünglichen Bausubstanz wurde möglich durch ein neues, materialoptimiertes Holztragwerk aus Brettschichtholz.

Die kleine deutsche Gemeinde Ingerkingen in der Nähe von Ulm hatte im Wettbewerb offengelassen, ob die bestehende Mehrzweckhalle saniert oder abgerissen und neu gebaut werden sollte. Als Zentrum des Dorflebens nutzen ortsansässige Vereine sie als Treffpunkt, Veranstaltungs- und Trainingsort – sie liegt in direkter Nachbarschaft zum Musikerheim und zur Feuerwehr, aber auch zur Grundschule. Letztere nutzt die Mehrzweckhalle auch für den Schulsport. Nicht zuletzt wurde sie nach den Plänen der Architekten Pfalzer und Schenk 1964 ursprünglich als Schulsporthalle errichtet. Nach Fertigstellung wurde sie mehrfach umgebaut und zu einer Mehrzweckhalle mit Bühne erweitert.

Bei dem 2020 ausgeschriebenen Wettbewerb setzte sich das Stuttgarter Architekturbüro Atelier Kaiser Shen mit dem Entwurf eines maximalen Bestandserhalts durch und bewahrte so die Mehrzweckhalle vor dem Abriss. Das Gebäude wurde im Anschluss einer Generalsanierung unterzogen. Ziel der Baumaßnahme war es, das Bestandsgebäude sowohl technisch als auch funktional und architektonisch an die heutigen Anforderungen an eine Mehrzweckhalle anzupassen. Dabei wurde der Baukörper durch eine Verschiebung der Südfassade und eine Aufstockung in Holzrahmenbauweise erweitert. Neben der bestehenden Einfeldhalle mit Bühne, Foyer, Küche mit Theke und Kühlraum sind nun Geräteräume, Technik, Stuhllager, Umkleiden, Sanitärräume und ein Vereinsraum integriert. Rund 60 Prozent der ursprünglichen Baumasse blieben beim Umbau erhalten, darunter die Fundamente, die Bodenplatte, Decken sowie die Massivwände im nördlichen Gebäudeteil und der straßenseitige Bühnentrakt. Diese Bestandsweiternutzung im Sinne von Upcycling und die darauf aufbauende Dachkonstruktion sowie die Erweiterung des Bestands waren ausschlaggebend für die Förderwürdigkeit des beispielhaften Sanierungs- und Erweiterungsprojekts, das sich gegen einen Neubau durchsetzte. Dass das neue Gesamtensemble damit nun auch eine völlig neue Ästhetik entfaltet hat, bestätigte die Entscheidung in jeder Hinsicht.
Neues Holztragwerk ermöglicht den Erhalt
Die Voraussetzung für den Erhalt des Bestands schuf ein neues Holztragwerk aus Brettschichtholz, das in enger Zusammenarbeit zwischen den Architekten und den Tragwerksplanern entwickelt wurde und das Gebäude überspannt. Hinzu kam, dass die Hallenlänge des Vorgängerbaus exakt den DIN-Anforderungen einer Einfeldsporthalle entsprach. So musste für eine normgerechte neue Halle nur die Südfassade rückgebaut und versetzt werden. Das dazugehörige Tragwerk besteht aus einhüftigen Zweigelenkrahmen aus Brettschichtholz (BSH) mit einer Länge von 20,95 m (Höhe: 6,70 m), die im Achsraster der bestehenden Stahlbetonstützen aneinandergereiht sind, wobei die BSH-Riegel gelenkig auf Stahlbetonstützen aufgelagert wurden, die in den Bestand eingestellt sind. Maßgeblich dabei war, die Schräge der Bestandsgiebelwand aufzunehmen und das Holztragwerk so zu konzipieren, dass sich die Lasten auf die neuen Fundamente in Achse der neuen Fassade konzentrieren und im Bereich des Bestands weniger Auflagerlasten ankommen. Entsprechend leiten die Halbrahmen etwa 60 Prozent der einwirkenden Lasten in die neuen Fundamente im Süden ein und 40 Prozent in den Bestand im Norden ab. Die horizontalen Lasten werden ausschließlich am Fußpunkt der Rahmenstützen abgetragen. Materialoptimiert ausgebildet, folgen die 24 cm breiten BSH-Rahmen dem Momentenverlauf und weiten sich trapezförmig zur biegesteifen Ecke hin auf. Für die biegesteife Ecke wiederum sollte eine möglichst reduzierte Verbindung von Stütze und Riegel gefunden werden. Eingesetzt wurden Gewindestangen mit einer Einbindetiefe von 90 cm. Dieses Maß bewegt sich knapp an den ausführbaren Parametern, denn 90 cm war das Maximum, was das Werk, das die Binder hergestellt hat, bohren konnte.



Dachauskragung schafft Entlastung und Wetterschutz
Die BSH-Riegel kragen zudem über die Glasfassade hinaus aus. So schafft die Dachauskragung, die zunächst nicht vorgesehen war, später aber in die Planung einbezogen wurde, im Süden eine wettergeschützte Terrasse, die bei gutem Wetter die Halle erweitert. Auch hat der Überstand weitere Vorteile: Zum einen entlastet er durch das Eigengewicht der Auskragung das Binderfeld und reduziert damit noch einmal die Last auf die Bestandsachse, was eine weitere Querschnittsoptimierung ermöglichte. Zum anderen konnte damit auch das Holztragwerk, also die Auskragung und die vor der Fassade angeordneten Rahmenstiele weitgehend vor Witterung geschützt werden.
Aufstockung und Fassade
Während die neue Südfassade (traufseitige Wand im Süden) in Holzrahmenbauweise und einer umgedrehten Pfosten-Riegel-Fassade errichtet wurde, haben die Planenden das Bestandsgebäude durch eine Aufstockung mit zwei gegenläufigen Pultdächern ergänzt, die neben den Funktionsräumen auch die Halle überspannen. Die Fassade des Holzrahmenbaus besteht aus einer Boden-Leisten-Schalung aus unbehandeltem, sägerauem Fichtenholz mit Standardprofilen 60/40 mm. Die Leisten wurden in Nord-Süd-Richtung verlegt, so dass sie an den West- und Ostgiebeln liegend und an der Nord- und Südfassade stehend eingesetzt wurden. Fenster, Lüftungsauslässe und Wartungstüren der Lüftungsanlage liegen hinter der durchlaufenden Lattung. Optisch wirken die Aufstockung und Erweiterung wie ein den Bestand umschließendes Holzvolumen. Das Bestandsmauerwerk wurde gedämmt und in Anlehnung an den Originalputz verputzt. Die Holzfassade bleibt unbehandelt und wird mit der Zeit vergrauen.
Wege zur Erweiterung
Im Norden markiert der neue Sportlereingang zusammen mit einer leichten Stahltreppe die Grenze zwischen Bestand und Erweiterung. Im Westen grenzen die gedämmten, verputzten Bestandswände an die hinterlüftete Holzfassade. Ein Versatz von etwa 12 cm zwischen dem Mauerwerk und der schlankeren Holzrahmenkonstruktion betont die Trennlinie zwischen Alt und Neu und die Plastizität des Bauwerks.
Das Energiekonzept kombiniert reduzierte technische Einbauten mit der Möglichkeit, diese einfach zu revisionieren: Die die natürliche Belüftung ergänzende Lüftungsanlage wurde auf ein Minimum reduziert und – soweit möglich – zugunsten einer einfachen Wartung sichtbar belassen. Aus Kostengründen bauten die Vereinsmitglieder die alte Halle ehrenamtlich zurück und verkauften Teile wie ausgebaute Sanitärobjekte oder verwerteten sie wieder, z. B, die bisherige Holzbekleidung des Hallenraums, die nun eine Waldhütte bekleidet.

Zugunsten des Bestands entschieden
Die Entscheidung, eine Sanierung statt eines Neubaus durchzuführen, wurde mit dem Ziel begründet, die graue Energie zu erhalten, den Erinnerungswert des Gebäudes zu bewahren und die vergleichsweise geringeren Sanierungskosten zu nutzen. Das innovative Holztragwerk, das eine weitgehende Erhaltung des Bestands ermöglichte, führte zudem dazu, dass die Baumaßnahme als Vorbild für viele sanierungsbedürftige Mehrzweckhallen in Baden-Württemberg eingestuft und als förderungswürdig anerkannt wurde.
Für das Projekt erhielt die Gemeinde als Bauherrin Fördergelder in Höhe von 75.600 Euro aus dem Sportstättenbauprogramm vom Land Baden-Württemberg, zusätzlich 360.000 Euro aus dem Ausgleichstock sowie 500.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Weiterhin wurde die Maßnahme mit rund 2.200.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Dazu kamen 250.000 Euro über das Programm Holz Innovativ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Innovation und Energiewende (EFRE 2014-2020) in Baden-Württemberg dank der Einstufung „modellhaftes Bauvorhaben“.
(bt)