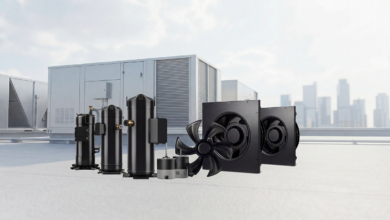Abgleich zahlt sich aus!
Ein korrekt ausgeführter hydraulischer Abgleich sorgt für mehr Effizienz in Heiz- und Kühlsystemen – und ist dabei ein echter Sparhebel. Der Beitrag zeigt die unterschiedlichen Varianten und ihre Einsatzbereiche, von der manuellen Lösung bis hin zum selbstlernenden System.

Der hydraulische Abgleich ist wie die Steuererklärung: Jeder weiß, dass es sich rechnet, doch bei der Umsetzung sind Investoren und Hausverwaltungen oft säumig. Interessant ist, dass es mehrere Möglichkeiten für einen hydraulischen Abgleich von gebäudetechnischen Anlagen gibt – vom einmaligen Abgleich bei der Inbetriebnahme bis hin zu adaptiven, automatischen Optimierungen im Betrieb. Welche Variante sich für welchen Einsatz empfiehlt, hängt vom Gebäudenutzungszweck, -alter sowie von technischen und räumlichen Gegebenheiten ab und kann nur nach einer fundierten Voranalyse bestimmt werden. Zusätzlich sind aktuelle und angekündigte gesetzliche und normative Bedingungen zu beachten.
Auf einen Blick
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und senkt spürbar die Energiekosten. Für Installationsbetriebe bieten sich damit neue Geschäftsfelder – von der Beratung bis zur Umsetzung. Drei technische Varianten stehen zur Verfügung: statisch, dynamisch oder adaptiv. Fördermittel unterstützen die Umsetzung, insbesondere im Wohnbestand. Fachwissen, Planung und die richtige Produktauswahl bleiben dabei entscheidend für den Erfolg.
Ungenutztes Potenzial
Während sich die Debatte über die Energiewende häufig um ausbleibende Förderungen oder mögliche Umrüst- bzw. Nachrüstungspflichten dreht, wird oft übersehen, dass in Heizungsanlagen viel ungenutztes Effizienzpotenzial steckt, das sich schon aus rein ökonomischen Gründen heben lässt. In Deutschland hat die Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) ermittelt, dass sich mit überschaubarem Aufwand bei Wohn- und Nichtwohngebäuden jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro an unnötigen Energiekosten und rund 5,3 Millionen Tonnen CO₂ einsparen ließen. Besonders im Gebäudebestand – etwa 70 Prozent der Gebäude in Deutschland stammen aus der Zeit vor 1979 – lässt sich durch einen hydraulischen Abgleich eine maximale Effizienzverbesserung erzielen. Übertragbare Vorteile gelten auch für Österreich.
Effizienzpotenziale nutzen
Von einem korrekt ausgeführten hydraulischen Abgleich profitieren Immobilienbesitzerinnen und -nutzerinnen direkt: Einsparungen werden unmittelbar nach der Inbetriebnahme messbar. Installationsbetriebe erhalten damit ein großes Betätigungsfeld für fundierte Beratung und Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen.
Im Kern geht es beim hydraulischen Abgleich darum, Wärme optimal auf alle Zonen und Räume zu verteilen. Dafür werden zunächst die Heizlast und anschließend die erforderlichen Wassermengen berechnet. Thermostatventile und Strangregulierventile werden auf die berechneten Werte voreingestellt. So wird selbst in Bereichen, die weit von der Heizpumpe entfernt sind, schnell die gewünschte Raumtemperatur erreicht. Durch den Wegfall von Überheizung und unnötigen Umwälzmengen senkt der Abgleich die Energiekosten. Studien zufolge liegt das Energieeinsparpotenzial im Durchschnitt bei zehn Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Auch im Kühlbetrieb – etwa mit Wärmepumpen, Bodensonden oder Betonkernaktivierung – ist eine gleichmäßige Versorgung und konstante Temperaturspreizung entscheidend. Fehlender Abgleich führt hier zu Kondensatausfall oder unzureichender Raumkühlung.
Für die Durchführung des Abgleichs können Fördermittel beantragt werden. Im Rahmen der Heizungsoptimierung im mehrgeschoßigen Wohnbau bezuschusst der Bund unter anderem den Einsatz automatischer Durchflussregler – einschließlich Material- und Installationskosten (Klimaaktiv/Kommunalkredit. ACHTUNG: diese Förderung ist ab 1.7.2025 ausgesetzt worden). Förderberechtigt sind Bestandsanlagen in Gebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten. Eigentümer*innen oder deren Verwaltung können über qualifizierte Installationsunternehmen den Abgleich durchführen lassen – auch bei Sanierungen wie Dämmung oder Fenstertausch, da dann eine Anpassung des Heizsystems zwingend notwendig wird.

Drei technische Wege zum Ziel
Neben zahlreichen Fördermaßnahmen auf Landes- und Gemeindeebene gibt es auch nationale und europäische Normen und Richtlinien, die den hydraulischen Abgleich vorschreiben. So wird aktuell etwa die OIB-Richtlinie 6 überprüft und an die Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) angepasst.
Ein traditioneller hydraulischer Abgleich, professionell durchgeführt, sorgt für gleichmäßige Wärme- und Kälteverteilung im gesamten System und reduziert Energieverbrauch – gilt jedoch als aufwendig, vor allem im Bestand. Möglich sind drei Varianten:
1. Statischer hydraulischer Abgleich
Die Durchflussmenge am Verbraucher wird manuell über voreinstellbare Ventile justiert. Diese Einstellung bleibt konstant. Ein Beispiel ist das TA-STAD Ventil von IMI Hydronic. Es erlaubt präzise Volumenstromregelung über eine Skala am Ventil und Messanschlüsse für Differenzdruckmessung (z. B. mit TA-Scope). Ein digitaler Messcomputer ermöglicht automatische Berechnungen und Dokumentation. Vorteile: hohe Genauigkeit, robuste Bauweise, ideal für größere Anlagen mit bekannten Lasten, kostengünstiger als dynamische Systeme.
2. Dynamischer hydraulischer Abgleich
Hier kommen druckunabhängige Ventile zum Einsatz. Der Abgleich erfolgt automatisch – unabhängig vom Differenzdruck im System. Die Ventile (z. B. IMI Heimeier Eclipse) halten den gewünschten Durchfluss konstant, auch wenn sich andere Ventile im System schließen. Vorteile: schnelle Inbetriebnahme, keine Nachjustierung, ideal für Sanierungen und bestehende Ventilgehäuse, geeignet für Radiatoren- und Flächenheizsysteme.
3. Adaptiver hydraulischer Abgleich
Diese Variante erfolgt über Algorithmen, die sich selbstständig an aktuelle Betriebsbedingungen anpassen. Das TA-Smart Ventil von IMI TA kombiniert Sensorik, Steuerung und Konnektivität. Messgrößen wie Durchfluss, Temperaturdifferenz und Ventilposition werden laufend überwacht. Vorteile: höchste Energieeffizienz, digitale Steuerung über App oder Gebäudeleittechnik, einfache Inbetriebnahme, Echtzeitdaten für Fehleranalyse und Optimierung, erfüllt gesetzliche Vorgaben wie die EPBD.
Abgleich braucht Fachwissen
Welche Lösung zum Einsatz kommt, hängt von den technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Der hydraulische Abgleich wird nach Fachregeln durch qualifizierte Installationsbetriebe umgesetzt. Grundlage ist die Heizlastberechnung nach ON EN 12831 – Wärmebedarfe dürfen nicht mehr geschätzt werden. Nur bei bekannter Raumheizlast kann eine sinnvolle Verteilung der Volumenströme erfolgen. Auch bei automatisierten Systemen bleibt die sorgfältige Planung unverzichtbar.
Ein richtig durchgeführter Abgleich reduziert Energiekosten, sorgt für Raumkomfort und minimiert Emissionen – unabhängig vom eingesetzten System.
Schulungen
Das Unternehmen IMI unterstützt gebäudetechnische Büros und Installationsbetriebe mit Schulungen zu hydraulischem Abgleich, Zonenregelung, Change-Over und Druckhaltung. Über die Plattform HyForum bietet IMI außerdem Support zu Themen wie hydraulischer Abgleich, Förderungen, Regelventile und Differenzdruckregler – und ermöglicht den fachlichen Austausch zu neuen Entwicklungen der Branche.
climatecontrol.imiplc.com
www.imiplc.com