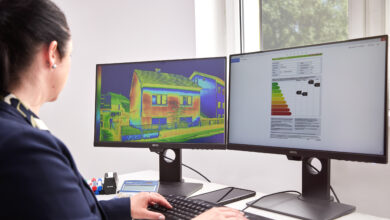Die Schmerzgrenze bei Vorarbeiten
Das Vergaberecht soll fairen Wettbewerb ermöglichen – oder, besser gesagt, erzwingen. Das führt dazu, dass sich nicht immer alle Unternehmer beteiligen dürfen, insbesondere solche, die bei der Vorbereitung des Vergabeverfahrens tätig waren („Vorarbeiten“).

Das Bundesverwaltungsgericht hatte über einen solchen Fall zu entscheiden. Ausgeschrieben waren Planungsleistungen. Ein Unternehmer war bereits seit 2016 am Projekt beteiligt und hatte die wasserrechtlichen Einreichunterlagen erstellt. Am Ende des Vergabeverfahrens gab der Auftraggeber bekannt, dass gerade dieser Unternehmer an erster Stelle liege. Ein Konkurrent wandte sich dagegen an das BVwG.
Offenlegung reicht nicht immer
Das BVwG hielt zunächst allgemein fest, dass solche Vorarbeiten dazu geeignet seien, den fairen Wettbewerb zu beeinträchtigen. Das bedeutet aber noch nicht automatisch – siehe § 25 bzw. im Sektorenbereich § 198 Bundesvergabegesetz 2018 – den Ausschluss des Vorarbeiters. Der Auftraggeber ist zunächst verpflichtet, Maßnahmen zur Ermöglichung des fairen Wettbewerbs zu setzen, insbesondere durch Bereitstellung aller Unterlagen, die der Vorarbeiter erstellt hat oder an denen er beteiligt war, an alle Bieter.
Dies hat auch der Auftraggeber im gegenständlichen Fall durch Offenlegung der Unterlagen aus dem wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren versucht.
Aber das reicht nicht immer aus. Es geht beim Vorarbeitenproblem im Kern darum, ob der Vorarbeiter, wie das BVwG festhält, „spezifische Kenntnisse des Sachverhalts erworben hat, die […] einen (nicht ausgleichbaren) Wettbewerbsvorteil begründen“. Das war hier laut BVwG der Fall.
Änderung der Kriterien und die Folgen
Auf Basis der ursprünglichen Ausschreibungsinhalte wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen. Aber während des Vergabeverfahrens ergab sich offenbar die Notwendigkeit, dass der künftige Auftragnehmer auch die Einreichplanung – auch die wasserrechtliche Einreichplanung, die der Vorarbeiter gemacht hatte – überarbeiten muss. Der Auftraggeber erweiterte daher den Leistungsgegenstand entsprechend. Und noch gravierender: Er änderte die Zuschlagskriterien derart, dass ein qualitatives Subsubkriterium namens „Modifikation Einreichplanung“ ergänzt wurde.
Was endgültig zum Kippen der angefochtenen Entscheidung führte, war dann der Umstand, dass der Vorarbeiter in diesem neuen Kriterium deutlich besser als der antragstellende Konkurrent bewertet wurde. Ohne dieses neue Kriterium wäre der Antragsteller vorne gelegen, nicht der Vorarbeiter. Das war für das BVwG zu viel. Es gab dem Antrag statt.
Kritik am Vorgehen des BVwG
Was an dieser Entscheidung allerdings nicht ganz überzeugt, ist Folgendes: Das BVwG hielt fest, dass nach seiner Ansicht die bessere Bewertung des Vorarbeiters im Kriterium „Modifikation Einreichplanung“ darauf beruhe, dass dieser jahrelange Vorerfahrungen und Kenntnisse der Örtlichkeit – und damit über die Problemstellung, die zu lösen war – habe, über die die anderen Bieter trotz Offenlegung der Unterlagen nicht verfügen könnten.
Diese Ansicht begründet das BVwG aber in keiner Weise, was in zweierlei Hinsicht problematisch ist. Erstens kann es wohl sein, dass eine qualitativ bessere Ausarbeitung eines Bieters auf Vorkenntnissen beruht; es kann aber auch sein, dass dieser Bieter im Vergabeverfahren schlicht bessere Arbeit abgeliefert hat. Ohne inhaltliche Analyse der Ausarbeitungen – die in der BVwG-Entscheidung zur Gänze fehlt – bleibt das Spekulation. Und daran schließt sich das zweite Problem an: Diese inhaltliche Analyse ist im Kern eine Tatsachen-, keine Rechtsfrage, wofür vom BVwG ein Sachverständiger zu bestellen gewesen wäre. Wenn das BVwG also die Rechtsansicht vertritt, dass es beim Vorarbeitenproblem nicht bloß darum geht, ob ein potenzieller Wettbewerbsvorteil besteht, sondern darum, ob tatsächlich das Vergabeverfahren dadurch anders ausgegangen ist, wäre dies wohl näher zu beleuchten gewesen.
Der Autor

RA Mag. Thomas Kurz ist Rechtsanwalt bei
Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH, Kundmanngasse 21, A-1030 Wien
www.heid-partner.at