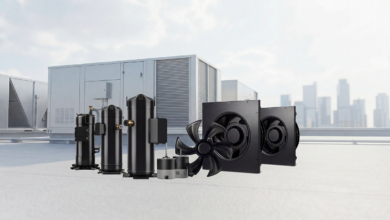Macht und Ohnmacht der Bürgermeister
Die wesentlichen Weichenstellungen für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung erfolgen weniger durch die Planungspolitik als durch Gesetze, Förderungen, Steuern und Abgaben, die auf den ersten Blick oft keine große Raumrelevanz vermitteln. Verantwortlich dafür sind Bund und Länder, faktischen Niederschlag finden deren Entscheidungen aber auf Ebene der 2.100 Städte und Gemeinden. Obwohl für Raumordnung zuständig, vermögen selbst engagierte Kommunen mit ihren Instrumenten kaum aus den strukturellen, rechtlichen und finanziellen Vorgaben auszubrechen. Dabei erweisen sich gerade Vertreter der untersten politischen Ebene zunehmend als letzte Hoffnungsträger einer nachhaltigeren, klimaschonenden Entwicklung. von Reinhard Seiß

Ein permanenter Energiebedarf von 2.000 Watt pro Person entspräche einem umweltverträglichen Lebensstil. Jeder Österreicher nimmt im Schnitt 6.000 Watt in Anspruch. Zwei Drittel davon entfallen auf den Bereich Bauten und Mobilität. Es erklärt sich von selbst, dass auch mit gut gemeinten Einsparungen beim Stromverbrauch unserer Einfamilienhäuser oder beim Treibstoffverbrauch unserer Zweitautos ein Abwenden der Klimakatastrophe völlig illusorisch ist. Es braucht einen grundsätzlichen Wandel – sowohl in der Siedlungsentwicklung als auch im Verkehr. Derselbe tiefgreifende Wandel ist auch im Umgang mit der Ressource Boden nötig: Zur Versorgung eines Menschen bedarf es rund 2.000 Quadratmeter Ackerfläche. In Österreich sind nur noch 1.500 Quadratmeter pro Einwohner vorhanden, und es werden jährlich weniger – zuletzt um über 10.000 Hektar, die wir mehrheitlich für unsere Siedlungstätigkeit vergeudeten.
Das alles ist seit mindestens zwei Jahrzehnten bekannt, und die wechselnden Bundes- und Landesregierungen haben auch darauf reagiert. Mit einer Nachhaltigkeitsstrategie etwa, die auf eine Reduktion des Bodenverbrauchs um rund 90 Prozent abzielte, freilich ohne die dafür nötigen Instrumente mitzuliefern – weshalb sich bis heute so gut wie nichts am Flächenfraß geändert hat.
Das aktuellste Beispiel solch haltloser Ankündigungspolitik ist die im Vorjahr präsentierte Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung. Sie bietet nur wenige klare Ziele und Fristen, kaum verbindliche Zahlen, offene Zuständigkeiten und eine Menge schwammig definierter Maßnahmen. Die Absicht von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger war und ist es, ohne Verbote, dafür aber mit positiven Anreizen jenen Turnaround zu schaffen, an dem Österreich seit den 1990er-Jahren scheitert. Wer daran Zweifel hegt, den mag die Erkenntnis von Vizekanzler Heinz-Christian Strache beschwichtigen, dass der Klimawandel ohnehin nichts mit unserem Lebensstil zu tun habe, zumal schon das alte Rom seiner Kornkammer in der Sahara durch meteorologische Unbilden verlustig gegangen sei.
Bekenntnis zu dringlichen Reformen
Deutlich ernsthafter, in jedem Fall aber intelligenter werden die großen Zukunftsthemen von immer mehr Kommunalpolitikern wahrgenommen, wie auch das jüngste Raumplanungssymposium von ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich vor Augen führte. Sei es aufgrund ihrer unmittelbaren Betroffenheit von den Auswirkungen einer sorglosen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, sei es ob des geringeren Einflusses institutioneller Lobbyisten auf ihre Entscheidungen: Bürgermeister unterschiedlicher Gemeindetypen und Parteizugehörigkeiten deckten sich im Rahmen der Fachtagung weitestgehend in ihrer kritischen Analyse der Probleme sowie in ihrem Bekenntnis zu überfälligen Reformen. Gleichwohl wurde klar, dass die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten der Kommunen allein nicht ausreichen, um die nötigen Veränderungen herbeizuführen. Jedenfalls sieht St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler seine 55.000-Einwohner-Stadt auch selbst in der Verantwortung, zum Klimaschutz beizutragen, was konkret durch den Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen sowie durch Wasserkraftnutzung an den alten Werksbächen geschieht.
Auch in Sachen öffentlicher Verkehr ist mit dem Stadtbussystem LUP ein erster Schritt getan. „Vor Einführung des neuen Fahrplans hatten wir 900.000 Fahrgäste pro Jahr, jetzt sind es fünf Millionen“, zeigt sich Matthias Stadler zufrieden, auch wenn er relativiert: „Natürlich sollte der Bus nicht am Stadtrand enden, sondern auch in die Umlandgemeinden fahren und am besten in den gesamten Zentralraum ausgedehnt werden.“ Doch scheitere dies bisher daran, dass vieles, das auch Geld koste, nach wie vor an Gemeindegrenzen haltmache.
Kontraproduktive Geldtöpfe von Bund und Ländern
„Dabei waren wir hier schon deutlich weiter“, erinnert St. Pöltens Stadtoberhaupt. „Vor über 50 Jahren nahm das Traisental eine Vorreiterrolle in der interkommunalen Kooperation ein, als sich die Gemeinden zusammenschlossen, um die Abwasserentsorgung gemeinschaftlich zu organisieren, anstatt dass jede ihre eigene Kläranlage baut.“ Im Laufe der Zeit hätten die Kommunen wegen ihrer Zusammenarbeit in verschiedensten Bereichen aber immer wieder steuerliche Nachteile erfahren, die ihre Bemühungen um Kosteneinsparung konterkarierten. Die Bereitschaft der Bürgermeister zur Kooperation bestehe weiterhin, so Stadler, doch funktioniere diese nur, wenn keiner seiner Kollegen fürchten brauche, dadurch Zuwendungen zu verlieren. Deshalb müssten öffentliche Geldtöpfe, die egoistische Vorgangsweisen von Kommunen nach wie vor belohnen, von Bund und Land raschest geschlossen werden. Denn gerade bei Themen wie Bodenverbrauch – Stichwort: Interkommunale Gewerbegebiete – oder Verkehr – Stichwort: Pendler – sei regionales Vorgehen ein Gebot der Stunde: „Wir müssen uns gemeinsam für ein Schnellbahnsystem einsetzen, ohne das wir den Arbeitsverkehr nicht umweltschonend bewältigen können werden“, fordert Stadler.
Kaum Handhabe gegen Spekulation
Doch geht es der Kommunalpolitik nicht nur um finanzielle Unterstützung von Bundes- und Landesseite. Auch legistische Maßnahmen würden eine andere Orts- und Stadtentwicklung ermöglichen. „Seit der letzten Bauordnungsnovelle dürfen Häuser, die nicht in gekuppelter oder geschlossener Bauweise errichtet wurden, ohne Genehmigung abgerissen werden, so sie nicht unter Schutz stehen“, kritisiert St. Pöltens Bürgermeister. „Die Folge ist, dass bei uns wie auch im Wiener Umland Spekulanten schöne alte Häuser, oft auch prachtvolle Villen auf großen Grundstücken um Preise kaufen, die in keiner Relation zum Wert des Gebäudes stehen, bei Abriss und deutlich dichterer Bebauung aber immense Renditen einbringen.“ So gehe wertvolle historische Bausubstanz verloren, ohne dass die Baubehörde etwas dagegen unternehmen könne.
Pendlerproblematik als Dilemma
Bürgermeister Johannes Pressl, studierter Landschaftsplaner und langjähriger Regionalmanager, ist im Grunde mit denselben Problemen konfrontiert, obwohl er einer Kommune mit nur 3.500 Einwohnern vorsteht – der Marktgemeinde Ardagger im westlichen Mostviertel. Auch er ist um einen klimagerechteren Verkehr bemüht und hat unter anderem Elektrotankstellen in jeder Katastralgemeinde errichtet. „Prinzipiell wäre es für die Pendler in unserer Gemeinde sehr attraktiv, nur bis Amstetten mit dem Auto oder E-Car zu fahren und dort in die Züge nach Wien, St. Pölten oder Linz umzusteigen“, weiß Pressl. „Doch ist das Parkhaus am Bahnhof in Amstetten völlig ausgelastet, sodass viele auf die Autobahn auffahren und auf diesem Weg zur Arbeit gelangen.“ Amstetten sträubt sich, ein weiteres Parkhaus am Hauptbahnhof zu errichten, nicht nur angesichts der offenen Finanzierung, sondern verständlicherweise auch deshalb, um nicht noch mehr Autoverkehr aus der Region ins Zentrum zu holen. Es scheint fraglich, ob die betroffenen Kommunen in der Lage sind, dieses Dilemma aufzulösen, solange es an Unterstützung der Bundes- und Landesverkehrspolitik mangelt.
Dauerbrenner Brache
Siedlungspolitisch sieht Pressl in seinem Bemühen um eine kompakte und effiziente Ortsentwicklung vor allem Unterstützungsbedarf beim Thema Leerstand – egal, ob es sich um Parzellen handelt, die oft Jahrzehnte nach ihrer Widmung noch immer unbebaut sind, oder um Zweitwohnsitze und Anlegerwohnungen, für die trotz seltener Nutzung dennoch die gesamte Gemeindeinfrastruktur bereitgestellt werden muss. Die Eigentümer solcher „Brachen“ stärker zur Kasse zu bitten – etwa durch eine spürbar erhöhte Grundsteuer auf gehortetes Bauland, um dessen Verkauf endlich in Gang zu bringen – wäre für Johannes Pressl ein wünschenswertes Instrument, das er freilich nicht im Alleingang ergreifen kann. „Wir haben diese Themen, die alle Kommunen betreffen, über den Gemeindebund immer wieder auch in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Länder eingebracht, es kam aber nie etwas dabei heraus.“ Dieselbe Erfahrung hat St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler gemacht, der für den Städtebund an den Finanzausgleichsverhandlungen teilgenommen hat: „Man sieht letztendlich, dass die Städte und Gemeinden in Österreich nur politische Leichtgewichte sind. Obwohl wir oft am besten wissen, wo der Schuh drückt, hat unsere Expertise keinerlei Bedeutung. Bund und Länder machen sich die großen Dinge ohne uns aus.“
Raumblinde Finanzpolitik
Der Finanzwissenschafter Johann Bröthaler vom Department für Raumplanung an der TU Wien attestiert dem Finanzausgleich ebenso wie vielen Förderungen und Bedarfszuweisungen eine weitgehende „Raumblindheit“ – sprich sie werden über ganz Österreich gleich verteilt, ohne auf Standortunterschiede Rücksicht zu nehmen oder ihre Wirkung auf die Siedlungsstruktur zu beachten. „Ob eine Gemeinde nahe bei Wien oder im oberen Waldviertel liegt, spielt für den Finanzausgleich genauso wenig eine Rolle wie für etwaige Wirtschaftsförderungen. Und auch ob ein Wohnbau im Zentrum oder auf der grünen Wiese entsteht, interessiert den Fördergeber kaum.“ Zudem widersprächen mitunter die Finanztransfers des Bundes und die Förderungen der Länder einander. Umgekehrt heißt das freilich, dass der Staat bei einem gezielteren Einsatz seiner Mittel, bei einer Koppelung von Finanzpolitik und Planungspolitik in hohem Maße nachhaltig wirken könnte – also klimagerecht, bodensparend und kosteneffizient. „Wir schreiben allerdings seit vielen Jahren immer wieder dieselben Reformkonzepte“, weiß Bröthaler um den chronischen Reformstau.
Viele Gemeinden würden die finanzpolitischen Anreize, die ihre Siedlungspolitik maßgeblich bestimmen, aber auch überschätzen. So wüssten alle, dass mehr Einwohner auch mehr Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich bedeuten – etwa 800 bis 1.200 Euro pro Neubürger. Nur wenige hingegen bedachten, dass mehr Einwohner auch höhere Ausgaben nach sich ziehen – und der Nettoeffekt laut Studien bei null liegt. Ähnliches gelte für neue Betriebsansiedlungen und den daraus lukrierten Steuerzuwachs: „Wenn eine Kommune mehr Kommunalsteuer einnimmt, bekommt sie an anderer Stelle weniger aus dem Finanzausgleich, sodass unter dem Strich oft nur die Hälfte übrigbleibt“, erklärt Bröthaler.
Kommunalpolitisches Engagement gegen Leerstand
Abseits großer staatlicher Transferzahlungen bemüht sich Matthias Hartmann um eine nachhaltigere Ortsentwicklung. Der studierte Politikwissenschafter ist Bürgermeister der Weinviertler Kleinstgemeinde Unterstinkenbrunn mit bloß 560 Einwohnern, Tendenz sinkend. Zur Mobilisierung längst erschlossenen, aber nichtgenutzten Baulands schwebt ihm eine Infrastrukturabgabe nach steirischem Vorbild vor: Wer eine Parzelle länger als fünf Jahre hortet, wird vor die Wahl gestellt, ob er für die bereitgestellte Infrastruktur zahlt, die Liegenschaft der Gemeinde veräußert oder aber eine Rückwidmung in Grünland in Kauf nimmt. „So etwas fehlt in Niederösterreich“, sagt Hartmann, angesichts oft immenser Baulandreserven peripherer Gemeinden. „Allerdings wäre es wichtig, dass das Land den Kommunen die Anwendung dieses Instruments nicht freistellt, sondern sie dazu verpflichtet. Denn sonst ist der Bürgermeister der Böse, der diese Schikane zu verantworten hat.“
Hartmanns Idee war es, als Anreiz für die Nutzung der vielen leerstehenden Wohnhäuser im Dorf eine Vermietungsförderung ins Leben zu rufen. Für eine neue Hauptwohnsitzmeldung in einem alten Haus schüttet die Gemeinde fünf Jahre lang 500 Euro per anno an den Eigentümer aus. Das sei nicht so viel, erklärt der Bürgermeister, aber es habe geholfen, die Hemmschwelle im ländlichen Raum, ein Haus zu vermieten, abzubauen: Ein Ansatz, der von Landesseite speziell für strukturschwache Regionen aufgegriffen werden könnte – um dort bestehende Bausubstanz zu nutzen, anstatt mit deutlich mehr Geld weitere Neubauten zu subventionieren. In den Pfarrhof von Unterstinkenbrunn ließ der Bürgermeister nach dem Tod des Pfarrers drei Wohnungen für junge Menschen einbauen, und eine weitere entstand in der alten Volksschule – wo auch ein Fitnessverein und der örtliche Musikverein eine neue Heimstätte gefunden haben. Laut Matthias Hartmann sind dies kleine, aber wichtige Schritte nicht nur in raumplanerischer Hinsicht, sondern auch, um die Dorfgemeinschaft am Leben zu erhalten.