Architektur und Baubiologie zusammendenken
Lebendige Architektur und Baubiologie sind keine kurzfristigen Trends, sondern entwickeln sich zu einem integralen Bestandteil moderner und nachhaltiger Baukultur. Ein Gastbeitrag von Christian Schaar.

Angesichts der Klimawende steigen die Anforderungen an Gebäude weiter: Ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Effizienz und flexible Nutzungskonzepte bestimmen zunehmend die Arbeit von Architekt*innen, Planer*innen und Baubetrieben. Konzepte wie die lebendige Architektur zeigen, dass Gebäude nicht starr, sondern dynamisch sein können. Durch die Verbindung mit baubiologischen Prinzipien ist es möglich, Gebäude zu planen und zu bauen, die die verschiedenen Lebensphasen der Bewohner berücksichtigen sowie Umwelt und Wohngesundheit gleichermaßen fördern. Im Mittelpunkt steht dabei eine ganzheitliche Planung, die Gebäude und Umgebung in Einklang bringt. Konkret bedeutet es, dass
- sich die Architektur an natürlichen Wachstumsprozessen orientiert,
- sich die Gebäude harmonisch in die Umgebung einfügen und die Charakteristika der Nachbarschaft widerspiegeln,
- Gemeinschaftsbereiche und Grünflächen in Gebäudekomplexe integriert werden,
- sich flexible Wohnräume an veränderte Lebensumstände anpassen lassen.
Die Baubiologie geht noch einen Schritt weiter und basiert auf der Auffassung, dass die gebaute Umwelt einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat. Ziel sollte es demnach sein, ein gesundes Wohnumfeld zu schaffen, das sowohl die Bedürfnisse des Einzelnen als auch die Anforderungen der Umwelt berücksichtigt. Zu den wichtigsten baubiologischen Prinzipien zählen unter anderem:
- Schaffung eines gesunden Innenraumklimas
- Vermeidung von Schadstoffen und Elektrosmog
- Verwendung ökologischer Materialien und Baustoffe
- Nutzung erneuerbarer Energiequellen
- Minimierung des Energieverbrauchs
- ressourcenschonende Bauweise
- harmonisch gestaltete Innenräume
- nachhaltige Wohnquartiere mit guter Anbindung und Grünflächen
Lebendige Architektur und baubiologische Prinzipien
Eine Verschmelzung von Baubiologie und lebendiger Architektur erscheint somit sinnvoll. Zu den wesentlichen Ansätzen einer solchen Verbindung zählt die Verwendung nachhaltiger und natürlicher Materialien, wie Holz oder Lehm. Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit, filtern Schadstoffe und können so Allergien und Atemwegserkrankungen vorbeugen und das Raumklima verbessern. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, regionale Baustoffe ohne lange Transportwege zu wählen. Zertifizierungen wie FSC (Forest Stewardship Council) für Holz oder Cradle to Cradle für andere Materialien garantieren eine nachhaltige Produktion und Nutzung.
Bei der Gestaltung von gesunden Innenräumen sind auch Belastungen durch elektromagnetische Felder auszuschließen. Neben der sorgfältigen Anordnung von Kabeln und Steckdosen bei der Wohnraumplanung kann ebenfalls die Drahtlosübertragung Li-Fi (Light Fidelity) als Alternative zu Wi-Fi berücksichtigt werden. Da Sender und Empfänger für die Datenübertragung mittels Licht eine direkte Sichtlinie benötigen, ist die Raumaufteilung dementsprechend zu konzipieren.
Ebenso essenziell ist die Energieeffizienz. Natürliche Baustoffe unterscheiden sich oft in ihrer Wärmeleitfähigkeit zu herkömmlichen Dämmstoffen, wodurch unter Umständen mehr Material für eine gleichwertige Dämmleistung notwendig ist. Fenster mit Dreifachverglasung bzw. Wärmeschutzgläser reduzieren zusätzlich Wärmeverluste, während Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr sorgen. Der Einsatz erneuerbarer Energien trägt schließlich maßgeblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei, etwa in der Kombination einer Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe.
Systeme zur Regenwassernutzung und Grauwasseraufbereitung sind innovative Lösungen, um Trinkwasser einzusparen. Regenwasser wird von den Dächern aufgefangen und in Speichern gesammelt, beispielsweise für die Toilettenspülung. Grauwasser aus Waschbecken und Duschen kann nach einer entsprechenden Aufbereitung für die Gartenbewässerung genutzt werden. Im Kontext von Baubiologie und lebendiger Architektur gewinnen im Besonderen Fassadenbegrünung und modulares Bauen an Bedeutung. Sie bieten ästhetische, funktionale und ökonomische Vorteile.
Begrünte Fassaden
Fassadenbegrünungen sind weit mehr als ein Gestaltungselement. Sie tragen zur natürlichen Wärmedämmung bei und reduzieren dadurch den Heiz- und Kühlbedarf erheblich. Zudem dienen sie als natürlicher Schallschutz, der Lärm mindert. Auch die Biodiversität im urbanen Raum wird dadurch gefördert, indem neue Lebensräume für Insekten und Vögel geschaffen werden. Nicht zuletzt steigert eine begrünte Fassade den Immobilienwert und erleichtert die Zertifizierung nach ökologischen Standards wie DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) und LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Je nach Bauprojekt gibt es unterschiedliche Systeme, wie zum Beispiel vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit modularen Pflanzkassetten, Rankhilfen für bodengebundene Kletterpflanzen sowie vertikale Gärten mit integrierter Bewässerung. Bereits in der Planungsphase sind statische Anforderungen, Lastabtrag und die Integration effizienter Bewässerungssysteme einzukalkulieren, damit eine dauerhafte und nachhaltige Nutzung gewährleistet ist. Mittels automatisierter Tröpfchenbewässerung können die Pflanzen kontinuierlich versorgt werden. Durchdachte Servicezugänge erleichtern die Pflege und Wartung der Fassadenbegrünung. Leichte Substrate und speziell entwickelte Unterkonstruktionen sorgen dafür, dass die Statik nicht unnötig belastet wird.
Flexible Lösungen
Das modulare Bauen etabliert sich wiederum zunehmend als Antwort auf die Bedarfe einer flexiblen und effizienten Bauwirtschaft. Besonders bei Aufstockungen und Erweiterungen im urbanen Bestand, aber auch bei Schulen und Kindergärten sowie Büro- und Gewerbebauten zeigt sich die Flexibilität dieses Ansatzes. Nutzungsflächen können modular skaliert und den Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden.
Durch die industrielle Vorfertigung verkürzen sich Bauzeiten deutlich, wodurch nicht nur Kosten gespart, sondern auch schneller auf Marktbedürfnisse reagiert werden kann. Des Weiteren erlauben modulare Systeme eine einfache Erweiterbarkeit: Zusätzliche Module können bei wachsendem Platzbedarf, wie bei Familienzuwachs, unkompliziert ergänzt oder bei geänderten Nutzungsanforderungen, etwa im Alter, wieder entfernt werden. Ein besonderes Augenmerk sollte auf der Wahl nachhaltiger Materialien liegen. Holzmodule binden beispielsweise sehr viel CO2 und punkten durch ihre natürliche Ästhetik.
Technisch sind bei modularen Bauten präzise Anschlussdetails besonders wichtig, um eine hohe Bauqualität zu sichern. Auch Brand- und Schallschutzanforderungen müssen konsequent berücksichtigt und umgesetzt werden. Die Integration vorinstallierter Haustechnikmodule erlaubt zudem Plug-and-Play-Lösungen, die die Bau- und Montagezeiten weiter reduzieren und die Effizienz erhöhen.
Potenziale für Architekt*innen und Bauunternehmen
Lebendige Architektur und Baubiologie sind keine kurzfristigen Trends, sondern entwickeln sich zu einem integralen Bestandteil moderner und nachhaltiger Baukultur. Wer heute in derartige flexible, ökologische Konzepte investiert, kann die gebaute Umwelt von morgen entscheidend mitgestalten. Immerhin ist abzusehen, dass die steigende gesellschaftliche Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und Gesundheit zu einer erhöhten Nachfrage nach umweltfreundlichen und gesunden Baukonzepten führt. Architekten und Bauunternehmen, die sich auf diese Bereiche spezialisieren und entsprechende Kompetenzen aufbauen, können sich von der Konkurrenz absetzen und sich ein zukunftssicheres Marktsegment sowie neue Kundengruppen erschließen. Überdies ergeben sich durch den Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit neue Geschäftsfelder, beispielsweise in der Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden unter ökologischen Gesichtspunkten oder in der Entwicklung und dem Vertrieb nachhaltiger Baustoffe und Technologien. Insgesamt kann die Integration von Baubiologie und lebendiger Architektur die Innovationskraft der Baubranche stärken und langfristig wachstumsstarke Perspektiven eröffnen.
Über den Autor
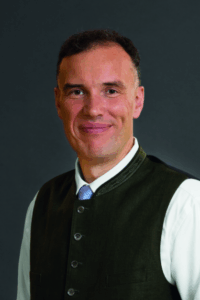
Christian Schaar ist Geschäftsführer der S2 GmbH (s2-architektur.com). Seine baubiologischen Kenntnisse erlangte er durch den täglichen Umgang mit Problemen der Baubiologie in verschiedenen Unternehmen des ökologischen Holzbaus. Als Geschäftsführer eines Planungsbüros, dessen Schwerpunkt ebenfalls der ökologische Holzbau ist, wird er bei Neubauprojekten und Sanierungen regelmäßig mit baubiologischen Fragen konfrontiert und als Experte auf diesem Gebiet konsultiert.




