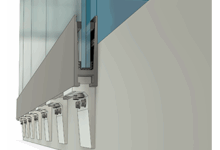Die real gewordene Utopie
Unter der Rubrik Wohnbau – ein historischer Streifzug startet FORUM als österreichische Fachzeitschrift für Baukultur eine neue Serie. Architektonische Leistungen der Vergangenheit werden aufgegriffen, um Impulse für aktuelle Wohnbauthemen zu bieten. Den Anfang macht die 1972 bis 1978 durch die Werkgruppe Graz errichtete Terrassenhaussiedlung St. Peter in Graz.

Der Oststeirer Rupert Sumpfhuber beschließt, in die Stadt zu ziehen. „Schon im Zug hatte er einen grundlegenden Entschluss gefasst: Sein Haus müsse einen Hausnamen und eine Hausnummer haben, wie er es von zu Hause gewohnt war. Das gäbe ihm Vertrauen und Sicherheit. Gesichtslose Häuser, die beides nicht verdienten, schloss er aus“, schreibt Architekt Eugen Gross in „10 Begeh(gn)ungen der unheimlichen Art“ 2008 über Rupert Sumpfhuber. Gross war Mitglied der Werkgruppe Graz und verfasste neben seiner Architektentätigkeit auch literarische Texte.
In dieser Geschichte begibt sich Sumpfhuber auf den Weg nach Graz und entdeckt dort die Terrassenhaussiedlung. Er beschließt, dieses reizvolle Konstrukt, welches so ganz anders im Vergleich zur benachbarten Verbauung ist, näher zu erkunden: „Da stand nun eine ganze, offensichtlich bewohnte Hügelkette vor ihm, bei der übereinander getürmt flache Häuser, massive Felsunterkünfte und lockere Hochsitze zu erkennen waren.“
Erster Großwohnkomplex Österreichs
Die Entwürfe zur Terrassenhaussiedlung stammen aus den Sechzigerjahren, als in Österreich die Wohnbauepoche des Wiederaufbaus endete. Die Wohnungsnot, resultierend aus den vorangegangen Weltkriegen, war beseitigt, und es vollzog sich eine Wandlung. Die Gesellschaft entwickelte sich hin zu Wohlstand und Fortschritt. Der Bausektor wurde durch technische Innovationen und neue Konzepte geprägt. Es wurden Utopien und Visionen erdacht. Die Planer beschäftigten sich mit neuen theoretischen Ansätzen. Themen wie Urbanität, Komplexität, Gemeinschaftlichkeit und modulares Bauen kamen auf und fanden ihren Ausdruck in umfangreichen Konzepten und den Gebäudestrukturen dieser Zeit.
Die Grazer Terrassenhaussiedlung St. Peter wurde in den Jahren 1972 bis 1978 als geförderter und somit sozialer Wohnbau errichtet und stellt das bekannteste und größte Projekt der Werkgruppe Graz dar. Die Anlage umfasst heute 528 Wohnungen, in denen zu Spitzenzeiten zirka 2.000 Menschen lebten.
Die Werkgruppe Graz, bestehend aus Eugen Gross, Friedrich Gross-Ransbach, Hermann Pichler, Werner Hollomey sowie Walter Laggner und Peter Trummer, entwarf mit der Terrassenhaussiedlung den ersten Großwohnkomplex in Österreich. In ihren Theorien definierten die Mitglieder der Werkgruppe Graz Werte der Gesellschaft und des Wohnens, die weit über einen formalistischen Ansatz hinausgingen. In den Konzepten und der Ausgestaltung der Anlage brachten sie diese zum Ausdruck. „Wir haben bestimmte aktuelle Anlässe aufgegriffen und selbst ein Programm entwickelt. Dieses haben wir dann bis zu einer Konzeption eines Baus, eines Projektes oder zum Teil auch bis zu einer Realisierung geführt. Ein Beispiel, das sichtbar wurde, ist die Terrassenhaussiedlung St. Peter, die in ihren Ursprüngen auf ein Konzept aus dem Jahr 1963 zurückgeht und dann schließlich nach langen Geburtswehen im Jahr 1972 zu einer Realisierung gekommen ist“, erzählt Eugen Gross.
Individuelles Wohnen in städtischer Verdichtung
Das Grundkonzept ist im Zuge eines verlorenen Wettbewerbs für Innsbruck/Völs entstanden und wurde zur Terrassenhaussiedlung weiterentwickelt. Es ermöglicht individuelles Wohnen in städtischer Verdichtung – eine gesellschaftliche Utopie. Der Aspekt der Partizipation spielte eine übergeordnete Rolle. „Wir wollten den Menschen weitestgehend Freiheit in der Grundrissgestaltung geben und haben 24 Wohnungstypen mit zahlreichen Veränderungsmöglichkeiten angeboten“, berichtet Gross weiter.
Das Konzept beruhte auf zwei Entwurfsphasen. Entwickelt wurde zunächst eine Primärstruktur der Gebäude. Definiert wurden Städtebau, Kubatur, Tragsystem, Infrastruktur und die verschiedenen Wohnungsgrundrisse. Die Sekundärstruktur entwickelte sich durch das Mitspracherecht der Bewohner in der Ausgestaltung ihrer persönlichen Wohnbedürfnisse.
Die Anfänge der Partizipation
Die Idee der Mitgestaltung des eigenen Wohnraums in der Stadt war neu – zu dieser Zeit revolutionär. Eine Bauhütte am Grundstück der heutigen Terrassenhaussiedlung galt als Anlaufstelle der Wohnungsinteressenten. Dort erfolgte die Auswahl der Wohnung am Modell. Die Bandbreite der Wohnungstyologien reichte von Garçonnièren über Maisonetten bis zu Dachwohnungen mit unterschiedlich zugeordneten Grün- und Freiräumen. Die Architekten entwarfen mit jedem der mehr als 520 Eigentümern deren Wohnung nach den persönlichen Wohnbedürfnissen. Somit wurden die zukünftigen Nutzer Mitplaner und damit ein Teil eines großen Ganzen. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem zukünftigen Wohnumfeld und die Möglichkeit der Mitgestaltung können als Faktoren für die bis heute hohe Wohnzufriedenheit in der Anlage gewertet werden.
Impulse provozieren
Der theoretische Ansatz und das Gesamtkonzept leitet sich vom Kernsatz der Gruppe und deren Leitvorstellung ab: „Die Architektur soll so wenig wie möglich festlegen, um so viel wie möglich an Impulsen zu provozieren.“ Die Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit der Planung der eigenen Wohnung aktivierte die Struktur. Dies ergänzt Gross wie folgt: „Für uns ist der Bau, wenn er fertiggestellt ist, eigentlich nicht abgeschlossen. Er ist immer eine offene Struktur, die weitergeht, die erst dadurch realisiert wird, indem er gebraucht und genutzt wird und zu einer Form des Lebens selbst wird. Damit ist gemeint, nur eine Struktur festzulegen, aber dem Einzelnen zu gestatten, innerhalb dieser Struktur selbst lebendig zu sein, zu spielen und diese Struktur zu aktivieren. Wenn es sein muss, die Struktur auch wieder abzubauen oder zu erweitern.“
Neue Maßstäbe setzen
Die Werkgruppe Graz setzte mit diesem Konzept neue Maßstäbe. Den Architekten ging es nicht einzig darum, Architektur zu bauen, sie wollten ein neues städtisches Lebensgefühl schaffen. Sie führten eine neue Ebene im geförderten Wohnbau ein – das Soziale als eine Form des Gesellschaftlichen. „Gerade der Wohnbau ist eine sehr gute Herausforderung, um menschliche Vorstellungen von Architektur zu verwirklichen. Denn gerade mit dem Wohnen verbinden so viele Menschen ihre innersten Wünsche, ihre unmittelbarsten Erwartungen, ihre Vorstellungen, schließlich hält man sich einen großen Teil seines Lebens in der Wohnung auf, man benützt die Wohnung auch, um sie anderen zu zeigen, um sich mit der Wohnung auszudrücken. All das zwingt dazu, Wohnen als eine Funktion zu sehen, die nicht nur individuell, sondern auch sozial interpretiert werden muss. Sozialer Wohnbau ist erst dann sozial, wenn er wirklich soziale Funktionen erfüllt – nicht, wenn er öffentlich finanziert wird. Wir haben in einigen Projekten, im Besonderen mit der Terrassenhaussiedlung versucht, dem ‚Sozialen‘ im ursprünglichen Sinn des Wortes Ausdruck zu verleihen, also auch sozial zu bauen, das heißt, den Menschen die soziale Dimension des Wohnens erleben lassen“, erklärt Eugen Gross.
Ein Bauvorhaben als Demonstration
Die Architekten definierten die Bauaufgabe selbst, suchten das Grundstück, den Bauträger und gestalteten den übergeordneten Rahmen. Die Idee der Demonstrativbauvorhaben aus Deutschland wurde aufgegriffen, und die Richtlinien für Österreich wurden adaptiert. Das Projekt erhielt den Status eines wissenschaftlich begleiteten Experiments. Begleitende Studien bezüglich der Themen Bautechnik, Bauphysik, Wohnbaupsychologie und Soziologie wurden durchgeführt. Die Erkenntnisse mündeten später in einem Zehn-Punkte-Katalog, der überpolitisch in ein Rahmenprogramm überging – in das Modell Steiermark.
Der eingangs erwähnte Neostadtbewohner Rupert Sumpfhuber unternimmt einen Spaziergang durch die Siedlung und trifft auf ganz unterschiedliche Bewohner. In seinen Gesprächen erfährt er viel über die Menschen und deren unterschiedliche Wohnbedürfnisse: „Zahlreiche Leute tummelten sich um ein Wasserbecken, in dem Kinder planschten, und einige improvisierte Marktstände boten ihre Waren an.“ Er ist erstaunt über die Vielfalt der Menschen, die Tür an Tür wohnen: der Bergsteiger, der Architekt, die Malerin, der Grüne, der Arzt, der Steingärtner, der Glücksspielberater, die Heilmutter, der Hausmeister und der Private. Es ist eine soziale Struktur, die ihm sehr gefällig ist. Diese Vielfalt, ausgedrückt in der Architektur einer Wohnhausanlage in der Stadt, hatte er nicht erwartet. Die Terrassenhausiedlung in Graz St. Peter ist eine real gewordene Utopie, die die Definition des sozialen Wohnens in sich trägt und lebt. Die intensive Auseinandersetzung der Werkgruppe Graz mit dem Wohnen in seiner ganzen Vielfalt gilt als Vorbild und Wegbereiter der sozialen Wohnbauten der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts in der Steiermark.
Von Andrea Jany