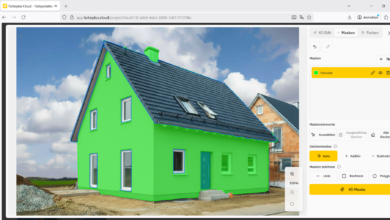Dämmen statt Dämmern
Die Dämmstoffbranche wartet auf die zukünftige Strategie der Regierung zur grünen Transformation des Gebäudesektors. Ihre Forderung: Klare, verbindliche Ziele zur Dekarbonisierung und Planbarkeit bei den Förderungen.

„Sehr wichtig!“ Das ist die Antwort von Robert Novak auf die Frage, wie wichtig die thermische Sanierung von Gebäuden für das Erreichen der Klimaziele ist. „Die thermische Sanierung ist einer der entscheidenden Hebel, um die österreichischen Klimaziele zu erreichen“, so der Geschäftsführer Vertrieb des heimischen Dämmstoffherstellers Austrotherm weiter. Er untermauert seine Aussage mit Zahlen. „Rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs entfällt auf den Gebäudesektor. Jeder schlecht gedämmte Altbau bedeutet also nicht nur steigende Heizkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch unnötige CO₂-Emissionen. Mit modernen Dämmstoffen lassen sich diese Emissionen massiv reduzieren, teilweise um mehr als 70 Prozent.“ Für Novak ist daher klar: „Wenn wir in Österreich unsere Klimaziele ernst nehmen, führt am Gebäudesektor kein Weg vorbei – und damit auch nicht an der thermischen Sanierung.“
Keine Wärmewende
„Ohne thermische Sanierung gibt es keine Wärmewende. Mehr als die Hälfte der notwendigen Energieeinsparungen bis 2050 hängt von einer gut sanierten Gebäudehülle ab“, meint auch Clemens Demacsek, Geschäftsführer des Branchenverbands GDI 2050 und verweist dabei auf Berechnungen der TU Wien. „Wer glaubt, man könne den Umstieg auf erneuerbare Energien ohne konsequente Sanierungen schaffen, irrt.“ Die Gebäudehülle, so Demacsek weiter, sei „nicht Beiwerk, sondern Fundament der Klimastrategie“.
Die Fragen, die sich die österreichische Dämmstoffbranche derzeit stellt, lauten: Sieht die Regierung das auch so? Wie ernst nimmt sie die Klimaziele. Und wie wichtig ist der Gebäudesektor in ihrer Strategie? Novak und seine Kollegen warten derzeit gespannt auf die zukünftige Förderstrategie der Regierung in Bezug auf die grüne Transformation des Gebäudesektors, nachdem sie die Förderungen Ende des Vorjahres abrupt gestoppt hat. Die Anzeichen lassen nicht Gutes erwarten. In einem Entwurf des Umweltministeriums zum neuen „Klimagesetz“ fehlt jedenfalls plötzlich das nationale Ziel, Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen – ein echter Rückschritt gegenüber zuvor vereinbarten Zielen der Republik. Auch Ziele und Fristen, heruntergebrochen auf einzelne Sektoren, fehlen.
Für die Manager der Dämmstoffbranche ist das der falsche Weg. Sie sind gewohnt, mit klaren Zielen und Vorgaben zu arbeiten und können mit den vagen Formulierungen der Politik wenig anfangen. „Klimaneutralität ohne Verbindlichkeit bleibt ein Papiertiger. Wer keine klaren Ziele und Zwischenetappen vorgibt, nimmt das Thema nicht ernst“, so Branchenvertreter Demacsek. „Gerade im Gebäudesektor brauchen wir feste Leitplanken, sonst verschiebt man notwendige Investitionen immer weiter nach hinten. Ein verbindliches Klimagesetz schafft Planungssicherheit und verhindert, dass Österreich beim Klimaschutz weiter im Schneckentempo agiert.“
Das „Ziel muss auf die einzelnen Sektoren heruntergebrochen werden, sonst wird das unserer Erfahrung nach nicht funktionieren“, ergänzt Rudolf Bergsleithner, Vertriebsleiter für Weber Terranova bei Saint-Gobain Austria, überzeugt. Er verweist, wie das in seinem Konzern gehandhabt wird: „Saint-Gobain hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dieses Ziel ist in viele messbare Meilensteine unterteilt, wie zum Beispiel bis 2030 die direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und 2) um 33 Prozent zu reduzieren.“
„Ein verbindliches Ziel zur Klimaneutralität bis 2040“ ist aus Sicht von Franz Wastlbauer ebenfalls „unverzichtbar“. Der Leiter Marketing, Produktmanagement, Anwendungstechnik der Synthesa Gruppe weiter: „Nur wenn dieses Ziel gesetzlich verankert und auf einzelne Sektoren wie Gebäude, Verkehr und Industrie heruntergebrochen wird, entsteht echte Verbindlichkeit. Klare Sektorenziele schaffen Planungssicherheit für Investitionen und bilden die Grundlage für ein wirksames Monitoring sowie die Einhaltung von Klimaschutzpfaden.“
Deutlich fällt auch der Kommentar von Austrotherm-Geschäftsführer Novak aus: „Dass das Klimaziel 2040 nicht verbindlich festgelegt ist, halte ich für eine vertane Chance“, so Novak. „Klimaneutralität darf kein ‚nice to have‘ sein, sondern muss ein klarer Auftrag an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sein. Gerade in unserer Branche brauchen wir Planungssicherheit. Niemand investiert in Produktionskapazitäten oder innovative Baustoffe, wenn die politischen Ziele schwammig bleiben.“
Die Branche verweist darauf, dass öffentliche Fördergelder für die thermische Sanierung volkswirtschaftlich gesehen ein lohnendes Investment darstellen. Die Förderung trage zum heimischen Bruttoinlandsprodukt bei und schaffe Arbeitsplätze, meint Georg Bursik, Österreich-Chef des Baustoffherstellers Baumit. Zudem würden durch eine verstärkte Sanierung Strafzahlungen nach Brüssel vermieden, die zu leisten sind, wenn die CO₂-Ziele der EU nicht erreicht werden. „Da ist es besser, in Österreichs Wirtschaft zu investieren“, sagte Bursik kürzlich gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).
Baumit hat die Universitätsprofessoren Friedrich Schneider und Martin Reindl beauftragt, die volkswirtschaftlichen Effekte der Förderung der thermischen Sanierung von Außenwänden wissenschaftlich zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden vor einigen Wochen präsentiert: Durch die staatliche Förderung der thermischen Sanierung von Außenwänden ergibt sich laut den Berechnungen der Professoren ein „dadurch ausgelöster BIP-Zuwachs-Faktor von rund 3,8“. Baumit formuliert das in einem Positionspapier folgendermaßen: „Jeder investierte Euro bringt fast viermal so viel an Wachstum als die Förderung selbst.“
Laut der Studie werden pro Million Euro Fördervolumen im Jahresdurchschnitt rund 30,6 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise geschaffen. Kommentar Baumit: „Die thermische Sanierung ist ein Beschäftigungsmotor.“ Zudem beziffert die Studie den Effekt der Förderungen auf das öffentliche Budget. „Infolge der Förderung beträgt der Zuwachs-Faktor bei indirekten Steuern rund 0,77 sowie bei direkten Steuern & Sozialabgaben rund 0,66“, heißt es. Jeder geförderte Euro fließe zu mehr als zwei Drittel wieder ins Budget zurück“, meint dazu der Baustoffhersteller in seinem Positionspapier.
Die beiden Professoren haben in einem weiteren Schritt die Effekte untersucht, die durch die Förderung des Kesseltauschs von fossilen Heizsystemen auf Wärmepumpen ausgelöst werden. Diese können sich ebenfalls sehen lassen, liegen aber unter den Werten für die thermische Sanierung: Der BIP-Zuwachs-Faktor beträgt 1,41 im Vergleich zu 3,8 und der Arbeitsplatzeffekt liegt bei 11,4 verglichen mit 30,6. Baumit Österreich-Chef Bursik hat daher eine eindeutige Forderung in Bezug auf die zukünftige Förderstrategie der Regierung: Zuerst dämmen, dann Heizungstausch. „Bisher wurde das Pferd von hinten aufgezäumt. Aus meiner Sicht war die Lobbying-Arbeit der Wärmepumpe recht gut.“
Bursik ist überzeugt, dass es sinnvoll wäre, in Zukunft die Fördermittel aufzuteilen. Die Gelder für thermische Sanierungen und Heizkesseltausch sollten aus unterschiedlichen Fördertöpfen gespeist werden, um Konkurrenz zwischen den beiden Förderungen zu vermeiden. Der Baumit Österreich-Chef empfiehlt eine 50-50-Aufteilung des Betrages.
„Die starke Konzentration der öffentlichen Mittel auf den Tausch von Heizkesseln halten wir für weniger hilfreich, bedenkt man die aktuelle Budgetsituation bei der öffentlichen Hand, aber auch im privaten Bereich. Wir würden es daher begrüßen, wenn nicht zuletzt aufgrund der budgetären Situation der Gebäudesanierung der Vorrang geben wird“, meint Saint-Gobain Manager Bergsleithner. Er schlägt vor, die Förderungen für thermische Sanierungen zu staffeln und an den erreichten Standard anzupassen. „Das würde die Unterstützungen transparent und nachvollziehbar machen – wer mehr für die Energieeffizienz tut, soll mehr bekommen.“
Synthesa Gruppe-Manager Wastlbauer wünscht sich ein Ende der regionalen Vielfalt im Förderdschungel. „Förderungen sollten österreichweit einheitlich und attraktiv gestaltet sein“, sagt er. „Eine Förderquote von mindestens 20 bis 30 Prozent der Investitionskosten ist notwendig, für sozial schwächere Haushalte auch deutlich höher. Wer umfassend saniert, sollte höhere Fördersätze erhalten als bei Einzelmaßnahmen. Auch Energieberatung, Planung und Baubegleitung sollten förderfähig sein.“