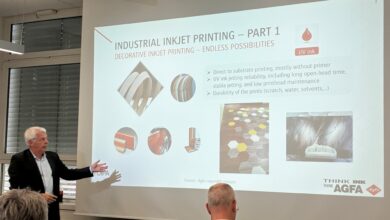Re-use statt Recycling
Die Baustelle von morgen arbeitet im Kreis: An der Wiener Boku erforscht ein Team, wie konstruktive Bauteile künftig nicht entsorgt, sondern wiederverwendet werden können.

„Wie können die enormen Mengen an Bauteilen aus Bauabbrüchen künftig wiederverwendet werden?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Forschungsteam der Universität für Bodenkultur (Boku) am Institut für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen im Projekt Kraisbau. Man könnte es auch so formulieren: Re-use statt Recycling. „Wiederverwendung wird sich nur dann flächendeckend durchsetzen, wenn sie nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich konkurrenzfähig ist“, meint Institutsleiter Benjamin Kromoser, der das Arbeitspaket leitet.
Alte Holzbalken neu im Einsatz
Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt das Team derzeit ein strukturiertes Framework, das präzise erfasst, welche Bauteile sich für eine Wiederverwendung eignen – und unter welchen Bedingungen diese ökologisch wirtschaftlich sinnvoll ist. Kromoser erläutert, wie Re-use in der Praxis ausschaut: „Ich kann etwa einen alten Holzbalken aus einem Gebäude ausbauen und ihn an anderer Stelle wieder einsetzen“, sagt er. „Das funktioniert auch mit anderen Bauteilen – zum Beispiel mit Betonträgern und Stahlträgern oder auch mit Wänden, Wandbeplankungen und Ständerwänden.“
Der ökologische und ökonomische Vorteil gegenüber dem Recycling kann beträchtlich sein. „Stahl kann man natürlich recyceln. Aber der Energieaufwand fürs Einschmelzen und die Produktion des neuen Elements ist hoch. Wenn ich einen Stahlträger wiederverwende, sparen ich die CO₂-Emissionen für diesen Prozess“, so Kromoser.
Ähnlich ist es beim Beton: Er ist ebenfalls recycelbar. Aber auch hier gilt: Das ist ein energieintensiver Prozess. Kromoser: „Der Beton muss zerkleinert werden, etwaige Bewehrung wie Stahl müssen entnommen werden – und bei der Produktion des neuen Betons muss wieder Zement verwendet werden, der für den Großteil der CO₂-Emissionen verantwortlich ist.“ Daher gelte hier ebenso: Re-use ist die nachhaltigere Alternative gegenüber dem Recycling. Dies lasse sich auch wissenschaftlich belegen: „Beispielsweise für eine Hohldielendecke zeigt sich eine Verbesserung der Ökobilanz um bis 75 Prozent.“
Re-use noch in den Anfängen
So sinnvoll Re-use ist, sie wird bislang noch nicht flächendeckend betrieben. Der Grund dafür ist laut Boku-Experte Kromoser einfach: „Es fehlt bislang an zwei Dingen. Es gibt noch keine klaren Regularien, die festlegen, welche Anforderungen für die Wiederverwendung von Bauteilen gelten. Und es gibt noch keine standardisierten Abläufe, die es ermöglichen, Re-use im großen Stil wirtschaftlich zu betreiben.“
Dieses Defizit will Kromoser mit seinem Team beheben. Im Projekt werden die Grundlagen für eine Standardisierung des Wiederverwendungsprozesses erarbeitet. Besonderes Augenmerk legen Kromoser und sein Kollege Maximilian Klammer dabei auf die Tragstruktur von Gebäuden, die den größten Materialanteil ausmacht – und damit ein enormes Potenzial für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bietet.
Das Forschungsteam widmet sich drei zentralen Fragen:
- Welche Bauteile und Materialien eignen sich für die Wiederverwendung?
- Wie verändert sich ihr Zustand im Laufe der Zeit?
- Wie viele Bauteile stehen in welcher Qualität zur Verfügung?
Um diese Fragen zu beantworten, entwickelt das Team ein standardisiertes Verfahren zur Gebäudeaufnahme. Dieses erfasst neben Geometrie und Materialeigenschaften insbesondere den Zustand bestehender Bauwerke bzw. Bauteile. Zum Einsatz kommen dabei neben klassischen optischen Verfahren auch moderne, wellenbasierte und nicht-invasive Prüfmethoden, die eine präzise Bewertung ohne Eingriff in die Bausubstanz ermöglichen.
Ablauf der Analyse
„Der Ablauf der Analyse erfolgt in mehreren Schritten“, erläutert Kromoser. Zuerst Foto- und Scanverfahren zum Einsatz, um die Geometrie, Verformungen, Risse oder Ablösungen an der Oberfläche zu erfassen. Nichtinvasive Methoden wie Ultraschall oder Radar können den Prozess unterstützen und erhöhen ergänzend die Genauigkeit der Bewertung – ohne die Bauteile selbst zu beschädigen. Begleitend werden potenzielle Schadenszonen identifiziert. „Nur bei besonders kritischen Bauteilen und Stellen – etwa tragenden Betonelementen, tragenden Stahlbauteilen oder Holzbauteilen – werden stichprobenartig gezielte invasive Detailanalysen durchgeführt, um die Ergebnisse weiter zu verfeinern“, so Kromoser.
Die erfassten Daten werden in einem mehrstufigen Analyseprozess ausgewertet. Kromoser: „Ziel ist der Aufbau einer strukturierten Datenbankarchitektur, in die Baustoffe und Bauteile systematisch eingepflegt werden.“ In dieser Datenbank werden alle relevanten Eingenschaften wie wie Geometrie, Baustoffe und Zustand eingepflegt. Kromoser weiter: „So steht dann umfassendes Wissen über verfügbare Bauteile zur Verfügung und ein Einsatz wird wesentlich einfacher wieder möglich – Bauherren, Planer*innen und Bauausführende können so einfach wieder auf diese zugreifen.“
Bauteile wiederverwenden
Im Labor des Instituts werden Techniken und Methoden, die zur Wiederverwendung von Bauteilen beitragen können, erprobt – von der Druckprüfung alter Vollziegel bis hin zur Integration dieser Materialien in neue, kreislauffähige Bauteile. Parallel dazu arbeitet das Forschungsteam daran, Planungsgrundsätze für die Kreislauffähigkeit von Gebäudebauteilen zu entwickeln.
Die gewonnenen Erkenntnisse zu Materialwerten, Aufbereitungsaufwand und Wiederverwendungspotenzial fließen in eine eigens entwickelten standardisierten Ablauf zum Re-use von Bauteilen ein. Der Projektleiter kann sich vorstellen, dass sich in Zukunft ein größerer Markt entwickelt, auf dem die Bauteile nach klaren Regeln gehandelt werden. Kromoser: „Wir wissen heute sehr genau, was es braucht, damit Wiederverwendung gelingen kann. Was noch fehlt, ist der Weg in die breite Umsetzung.“