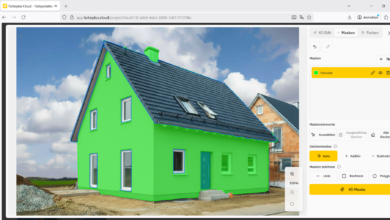Mehr Geld für aktive Bauteile
Die Thermische Bauteilaktivierung kommt bei Neubauten in Österreich immer häufiger zum Einsatz. Es könnte aber noch häufiger sein. Die Zukunftsagentur Bau (ZAB) fordert den Bund daher auf, rasch ein neues Förderprogramm aufzusetzen.

„Jede neue Betondecke ohne TBA ist eine verlorene Chance.“ Gunther Graupner, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Bau (ZAB) hat zum Thema TBA eine mehr als klare Meinung. Das Kürzel TBA steht für „Thermische Bauteilaktivierung“. Die Technologie bietet aus Sicht von Graupner ein „enormes Potenzial, um die Dekarbonisierung des Gebäudesektors voranzutreiben“. Um dieses Potenzial auszunutzen, fordert der ZAB-Geschäftsführer eine gezielte Förderung durch die öffentliche Hand: „Mit verhältnismäßig wenig Mitteln kann man einen kräftigen Schub geben.“
40 Prozent weniger Emissionen
Graupner weiß, wovon er spricht. Die ZAB befasst sich seit Jahren intensiv mit dem Thema. Das Konzept der TBA ist einfach erklärt: In die Betonmasse von Wänden oder Decken werden Rohrsysteme verlegt. Durch die Rohre kann man warmes oder kaltes Wasser leiten, mit denen man je nach Bedarf den Raum heizt oder kühlt. Die Betonmasse ist in der Lage, Wärme und Kälte zu speichern. Daraus ergibt sich der große Vorteil der TBA: „Zahlreiche Studien belegen, dass man die Energiekosten beim Betrieb um 30 bis 50 Prozent und die CO₂-Emissionen um bis zu 40 Prozent senken kann“, so Markus Leeb, Forschungsgruppenleiter Adaption of Built Environment bei der ZAB.
Leeb beschreibt auch das Potenzial, das die Technologie bietet: „Wenn man alle Haushalte in Österreich mit einer TBA ausstatten würde, könnte damit Energie im Ausmaß von 204 Gigawattstunden pro Tag erzeugt werden. Zum Vergleich: Der tägliche Stromverbrauch in Österreich liegt bei 136 Gigawattstunden.“ Das sei, so Leeb einschränkend, „natürlich ein theoretischer Vergleich, aber er verdeutlicht die Möglichkeiten.“
Die Vorzüge der TBA haben sich auch bei den Bauträgern herumgesprochen. „Im Bereich der Bürobauten gehört die Technologie in Österreich mittlerweile schon zum Standard“, meint ZAB-Geschäftsführer Graupner. Und auch im Wohnbau zeigt die Tendenz nach oben. So sind beispielsweise in der Seestadt Aspern in Wien ein Großteil der Wohnungen bauteilaktiviert. Zu den weiteren aktuellen Beispielen zählten das Wiener Stadtentwicklungsprojekt „Viertel hoch zwei“ und die Wohnhausanlage „Mühlgrundgasse – ebenfalls in Wien.
Graupner sieht bei der Verbreitung der Bauteilaktivierung in Österreich ein signifikantes Ost-West-Gefälle: „Sie ist im Osten deutlich populärer als im Westen.“ Warum das so ist, liegt aus Sicht der Experten ziemlich klar auf der Hand. Im Westen des Landes ist das Klima deutlich kühler. Das hat sich im Rahmen eines Forschungsprojekts der ZAB bestätigt. So verzeichnete Salzburg in den Jahren von 2000 bis 2019 im Durchschnitt 38 Sommertage, in St. Pölten waren es 63. Und durch den Klimawandel wird es bekanntlich wärmer. In Salzburg soll die Zahl der Sommertage bis zum Jahr 2050 auf 62 steigen, in St. Pölten sogar auf 80. Das bedeutet: Der Leidensdruck in Sachen Sommerhitze ist im Osten deutlich größer. Mithilfe der Bauteilaktivierung kann man hier energiesparend Abhilfe schaffen. Die TBA ist außerdem sehr gut geeignet, um mit erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik und Geothermie sowie mit Wärmepumpen kombiniert zu werden. Denn die Wärme aus selbst erzeugtem Solarstrom kann effizient zum Heizen oder Kühlen genutzt und im Bauteil gespeichert werden. Wärmepumpen arbeiten bei niedrigen Vorlauftemperaturen am effizientesten. Diese Kombination macht die Gebäude unabhängiger von fossilen Brennstoffen und senkt die Betriebskosten
Die hohe Popularität der TBA im Osten zeigen auch die Ergebnisse eines Förderprogramms, das der staatliche Klima- und Energiefonds (KLIEN) von 2021 bis 2023 durchgeführt hat. Drei Viertel der Projekte stammten aus Wien (65 Prozent) und dem Burgenland (10 Prozent). Auf Salzburg entfielen 20 Prozent, auf die Steiermark die restlichen 5 Prozent. Im Rahmen dieser KLIEN-Förderung wurden die Planungsarbeiten für TBA-Vorhaben im Wohnbau gefördert. Mit einem moderaten Mitteleinsatz von 1,5 Millionen Euro wurde die Bauteilaktivierung von 1.600 Neubauwohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von 190.000 m² unterstützt.
„Diese Förderung war ein voller Erfolg. Sie hat dazu beigetragen, die Bekanntheit der TBA bei den Bauträgern, den Bauphysik-Büros und den ausführenden Unternehmen zu erhöhen“, meint ZAB-Geschäftsführer Graupner. Aber eine einmalige Förderungsaktion sei nicht ausreichend. „Eine derartige Transformation ist nicht in wenigen Jahren möglich. Sie braucht in der Regel bis zu zehn Jahre.“
Graupner fordert daher vom Bund, ein neues Förderprogramm aufzulegen. „Mit einem Fördervolumen von drei Millionen Euro, könnte man schon viel bewegen“, so der ZAB-Geschäftsführer. Nachsatz: „Im Bundeshaushalt ist das ein Klacks.“ Mit der erneuten Förderung könnte man auch die Berührungsängste, die es noch bei Bauphysikern, Baumeistern und Installateuren gibt, reduzieren. Die mangelnde Vertrautheit dieser Berufsgruppen führt vor allem am Land oftmals dazu, dass angedachte TBA-Vorhaben dann doch nicht in die Tat umgesetzt werden. Graupner: „Wenn es in der Gemeinde oder in der näheren Umgebung keine Baumeister und keinen Installateur gibt, die mit dem Thema vertraut sind, dann wird oftmals nichts aus dem Projekt.“
Die Vertrautheit steigern soll auch die „Innovationslandkarte“ der ZAB. Hier hat man 120 TBA-Projekte in ganz Österreich aufgelistet und ausführlich beschrieben (siehe Kasten). „Es genügt nicht, von Innovation nur zu reden. Man muss sie am konkreten Beispiel veranschaulichen“, ist Geschäftsführer Graupner überzeugt. „Wenn ich als Baumeister sehe, dass der Kollege in der Nachbargemeinde schon ein derartiges Projekt umgesetzt hat, erhöht meine Motivation, mich damit zu befassen: Das sollten wir uns auch anschauen.“
Simon Handler, Geschäftsführer des Beraters Hacon Consulting hat „in der Praxis wir bei vielen Neubauten und Sanierungen durchwegs positive Erfahrungen mit der Bauteilaktivierung gemacht“. Handler: „Ich bin überzeugt, dass die TBA eine Schlüsseltechnologie zur nachhaltigen Versorgung moderner Gebäude ist.“ Und auch Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister der Bauwirtschaft, schätzt die Technologie: „Die Bauwirtschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst, einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Die thermische Bauteilaktivierung ist eine Schlüsseltechnologie, die wir aktiv fördern müssen“, so Jägersberger. „Sie ermöglicht es uns, Gebäude energieeffizienter auszuführen und den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Für die Zukunft bietet uns diese klimafreundliche Technologie eine große Chance.“
Die Innovationslandarte der ZAB:
Die Innovationslandkarte bietet eine Sammlung von innovativen Bauprojekten zu unterschiedlichen Themenbereichen. Zum Thema „Thermische Bauteilaktivierung“ sind mehr als 120 Projekte aus 4 Ländern eingetragen. Die Projekte reichen von Sanierungen mit nachträglich eingefrästen Leitungen, über Neubau Mehrfamilienhäuser, bis hin zu öffentlichen Bauten wie Schulen, Universitätsgebäuden oder Büros. Die Innovationslandkarte: www.zukunft-bau.at/bauteilaktivierung.