Auftakt zur Architekturbiennale in Venedig
Die 19. Internationale Architekturausstellung in Venedig steht im Zeichen fundamentaler Transformationen. Kurator Carlo Ratti stellte bei der heutigen Eröffnungspressekonferenz das Konzept „Intelligens. Natural. Artificial. Collective.“ vor – ein Plädoyer für neue Denkweisen im Angesicht des Klimawandels, wachsender Komplexität und gesellschaftlicher Fragmentierung.

Mit dem Thema „Intelligens. Natural. Artificial. Collective.“ eröffnet die 19. Internationale Architekturausstellung in Venedig eine Debatte über den Umgang mit einem sich rasant wandelnden Planeten. Kurator Carlo Ratti plädiert für ein neues Architekturverständnis, das jenseits technischer Lösungen auf kollektive Prozesse, transdisziplinäre Zusammenarbeit und das Potenzial zur Anpassung setzt. Die Ausstellung versammelt über 750 Mitwirkende aus 89 Ländern – von Architekt*innen über Klimaforscher*innen bis zu Köch*innen und Aktivist*innen – und macht Venedig selbst zur Versuchsanordnung für neues Bauen im Zeitalter der Krise.
Ein Auftakt mit programmatischer Schärfe
Bei der heutigen Pressekonferenz in den Giardini von Venedig wurde deutlich: Die Biennale Architettura 2025 will mehr sein als ein Branchentreffen – sie versteht sich als Labor, Bühne und Weckruf zugleich. Kurator Carlo Ratti, Architekt, Ingenieur und Leiter des MIT Senseable City Lab, legte ein deutliches Statement vor: Angesichts eines Jahres 2024 mit den weltweit höchsten gemessenen Temperaturen und einem zunehmenden Auseinanderdriften von Gesellschaft, Ökologie und Planungssystemen sei die Zeit der reinen „Mitigation“ vorbei. Architektur müsse wieder lernen, sich anzupassen – an neue klimatische, soziale und ökonomische Realitäten.

„Wir brauchen eine Architektur, die sich nicht länger als autonomes Kunstsystem versteht, sondern als aktiver Teil einer kollektiven Intelligenz“, so Ratti. Der Titel der Ausstellung, Intelligens, ist ein bewusst gewähltes Neologismus. Er verbindet das englische „intelligence“ mit dem lateinischen Wort gens – „die Menschen“. Die daraus abgeleitete Dreigliederung der Schau folgt drei Denkachsen:
- Natural Intelligence – wie Pflanzen, Ökosysteme und biologische Logiken das Bauen prägen können,
- Artificial Intelligence – die Rolle digitaler Systeme, Algorithmen und Robotik im Entwurfsprozess,
- Collective Intelligence – die gesellschaftliche, geteilte und nicht-institutionelle Wissensproduktion.
Über 750 Stimmen, ein Netzwerk von Ideen
Die Hauptausstellung umfasst über 300 Beiträge von Einzelpersonen, Initiativen und Forschungseinrichtungen aus 89 Ländern. Mitwirkende sind Architekt*innen, Mathematiker*innen, Klimaexpert*innen, Designer*innen, Künstler*innen, Programmierer*innen, Köch*innen, Bäuer*innen, Aktivist*innen und viele mehr. Nie zuvor war die Biennale so bewusst auf Vielfalt und Interdisziplinarität ausgerichtet. „Intelligens“ ist kein klassischer Überblick, sondern ein Fraktal – ein System, das sich aus modularen Einzelteilen zusammensetzt und Besucherinnen zum aktiven Durchqueren und Zusammenfügen einlädt.
Im ersten Ausstellungsabschnitt – den historischen Corderie dell’Arsenale – stehen die dramatischen planetaren Gegensätze im Zentrum: steigendem Temperaturanstieg stehen sinkende Bevölkerungszahlen gegenüber. Dieser Einstieg fungiert als visuelles und analytisches Brennglas für die Herausforderungen, denen sich Architektur heute stellen muss.
Im Kontrast dazu steht der Bereich Out in der Artiglierie, in dem unter anderem Projekte zum Leben im All, zur orbitalen Infrastruktur und zur planetaren Ethik vorgestellt werden. Nicht als technophile Utopie, sondern als kritisches Nachdenken über irdische Grenzen.
Die Biennale als Stadtlabor

Ein Novum der diesjährigen Ausgabe ist die bewusste Ausdehnung der Ausstellung in den städtischen Raum: Durch die Renovierung des Central Pavilion in den Giardini wurde Venedig selbst zur erweiterten Bühne. Die Stadt im Klimastress, ein bedrohtes historisches Ökosystem, wird zum Living Lab, in dem Prototypen, Installationen und Experimente in Echtzeit mit der Umgebung interagieren. Diese „Special Projects“ sind dezentral über das gesamte Stadtgebiet verteilt – vom Arsenale über Forte Marghera bis zu Universitäten und öffentlichen Räumen.
Ein Teil dieser Projekte ist als Kanon gedacht: eine exemplarische Sammlung von Lösungen, die als Referenz für den architektonischen Umgang mit komplexen, vernetzten Herausforderungen dienen sollen.
Öffnung der Autorenschaft: „Space for Ideas“
Ein weiteres zentrales Element der kuratorischen Handschrift Rattis ist die Demokratisierung des Entwerfens: Mit dem Programm Space for Ideas wurden weltweit offene Einreichungen ermöglicht. Der daraus entstandene Pool an Beiträgen sei nicht nur inhaltlich vielfältig, sondern habe neue Stimmen sichtbar gemacht, die in klassischen Auswahlprozessen wohl übersehen worden wären. Entsprechend wird auch das Prinzip der Autorenschaft neu gedacht: Weg vom „Mastermind“, hin zu kollaborativen, akademisch inspirierten Zuschreibungen, bei denen alle Beteiligten gleichermaßen Anerkennung erfahren.
GENS: Konferenzen und Kritik als öffentlicher Akt
Parallel zur Ausstellung läuft das ambitionierte Veranstaltungsprogramm GENS – benannt nach der „Menschen-Intelligenz“. Konferenzen, Diskursformate und Workshops finden in der Sala delle Colonne und im Teatro Piccolo Arsenale statt. Hier diskutieren internationale Gäste – darunter Politiker*innen, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Bürger*innen – über Themen wie Klimagerechtigkeit, Zukunft der Stadt, digitale Gemeingüter und neue Formen des Lernens. Ergänzt wird das Programm durch das Format Restaging Criticism, eine Serie zur Architekturkritik der Gegenwart, kuratiert von Christopher Hawthorne und Florencia Rodriguez.
Österreichischer Beitrag: Wien und Rom im Vergleich

Vor diesem Hintergrund positioniert sich der österreichische Beitrag „Agency for Better Living“ pointiert innerhalb der kollektiven Intelligenz. Kuratiert von Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito, wird der Wiener soziale Wohnbau mit den selbstorganisierten Wohnformen Roms kontrastiert – zwei Systeme, zwei urbane Kulturen, zwei mögliche Zukunftspfade. Im Zentrum steht die Frage: Wie lassen sich Erfahrungen institutionalisierter Fürsorge und informeller Aneignung produktiv verschränken?
Der Pavillon nutzt die symmetrische Architektur von Josef Hoffmann, um die „Stadt, die plant“ (Wien) und die „Stadt der Improvisation“ (Rom) gegenüberzustellen. Die Mitte des Pavillons ist als „Space of Negotiation“ konzipiert – eine Plattform für Austausch und Diskussion, zugleich Bühne und Denkraum. Der Beitrag thematisiert unter anderem aktuelle Beispiele aus Wien, wie das Sonnwendviertel, das Nordbahnhof-Areal oder Gender Planning-Strategien – sowie informelle Wohnorte in Rom wie Spin Time oder Metropoliz, die als Modelle kreativer Aneignung vorgestellt werden.
Internationale Jury: Vielfalt der Perspektiven
Die diesjährige Jury besteht aus:
- Hans Ulrich Obrist (Präsident), Serpentine London
- Paola Antonelli, MoMA New York
- Mpho Matsipa, Architektin und Theoretikerin aus Südafrika
Vergeben werden u. a. der Goldene Löwe für den besten nationalen Beitrag und der Silberne Löwe für eine besonders vielversprechende Nachwuchsposition. Bereits bekannt ist die Auszeichnung der Philosophin Donna Haraway mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk – ein Zeichen für die neue, transdisziplinäre Offenheit der Biennale.
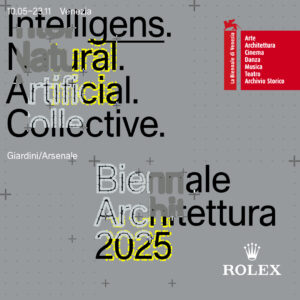
Die Biennale Architettura 2025 auf einen Blick
Titel: Intelligens. Natural. Artificial. Collective.
Zeitraum: 10. Mai bis 23. November 2025
Ort: Giardini, Arsenale, Forte Marghera und weitere Orte in Venedig
Österreichischer Beitrag: Agency for Better Living – eine vergleichende Schau zu Wien und Rom
Website: www.labiennale.org




