Mapping the Zero Carbon City: Stadtplanung und Klimaschutz
Die Forschungskooperation MetroLab von CoCo Architecture in Bordeaux und Superwien Urbanism beschäftigt sich mit Metropolenplanung. Mit „Mapping the Zero Carbon City“ liegt nun ein praktisches Handbuch mit zahlreichen Karten und Visualisierungen vor, das konkrete Möglichkeiten von Dekarbonisierung präsentiert. Wir haben mit Stefan Mayr von Superwien darüber gesprochen.

Wie können Städte ihren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig lebenswerter werden? Diese Frage steht im Zentrum des Projekts Mapping the Zero Carbon City, einem praxisorientierten Handbuch mit Karten, Analysen und Strategien zur Dekarbonisierung urbaner Räume. Entwickelt wurde es von der Forschungskooperation MetroLab, einer Zusammenarbeit zwischen CoCo Architecture in Bordeaux und Superwien Urbanism in Wien. Im Fokus steht die europäische Stadtregion als Hebel für Klimaschutz – mit konkreten Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Ressourcen und Stadtplanung. Über Herausforderungen, Erkenntnisse und Visionen haben Susanne Karr und Stefan Böck mit Stefan Mayr gesprochen. Als Architekt (ZT) und Experte für Urban Design und Produktdesign ist Stefan Mayr eine der zentralen Personen von MetroLab.
Architektur & Bau FORUM: 75 Prozent der Bevölkerung in der EU leben in Städten, gleichzeitig verbrauchen Städte weltweit ungefähr 65 Prozent der Energie und erzeugen 70 Prozent der CO₂-Emissionen. Wie errechnen sich diese Zahlen?

Stefan Mayr: Die Zahlen entstammen dem Horizon Europe Programm und beziehen sich nicht nur auf den engeren Begriff der Stadt, sondern inkludieren, wie bei unserem Projekt „Mapping the Zero Carbon City Region“, auch das Umland. Zu den direkten Emissionen von Abgasen oder Heizungen werden die indirekten hinzugezählt, die beispielsweise bei der Energieproduktion oder der Herstellung von Produkten entstehen. Auch der Transport spielt eine große Rolle. So ergibt sich diese hohe Zahl.
Neben Verdichtung und lokaler Nahrungsversorgung setzt ihr bei der Etablierung der 30-Minuten-Erreichbarkeit aller wichtigen Anlaufstellen in der Stadt an. Welche Schritte sind momentan die dringlichsten?
Bei unserer Arbeit untersuchen wir die fünf Themen Producing, Moving, Living, Consuming und Wasting für die Wiener Stadtregion. Im Bereich Mobilität (Moving), steigen die Emissionen weiterhin am stärksten. Wir greifen auf die Idee der 15-Minuten-Stadt zurück: Die wichtigsten täglichen Bedarfe wie Arzt, Schule, Lebensmittelgeschäfte oder Freizeiteinrichtungen sollen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Auf die Stadtregion umgelegt, geht es um ein 30-Minuten-Territorium. Wichtig ist die Polyzentralität, bei der die Stadt-Land-Verflechtung bewusst am Thema nachhaltige Mobilität ansetzt und Knotenpunkte schafft.
Das adressiert diejenigen, die darauf einwirken können, dass sich die Städte in die richtige Richtung bewegen.
Für uns stand zunächst das „Mapping“, also die Visualisierung durch Karten im Zentrum. In der Stadt Wien funktioniert der öffentliche Verkehr gut, und Radwege werden ausgebaut. Das gilt es auf die Stadtregion umzulegen. Dazu müssen verschiedene Bundesländer Dialoge führen, um Pendeln und Freizeitwege länderübergreifend aufeinander abzustimmen.
Die tierbasierte Lebensmittelindustrie zählt zu den größten Emittenten, wird aber in öffentlichen Debatten kaum thematisiert. Während über Flugreisen und Autofahrten diskutiert wird, bleibt die Ernährung oft außen vor – mit Verweis auf individuelle Entscheidungen.
Für eine nachhaltige Veränderung in Lebensmittelproduktion und Konsumverhalten muss überdacht werden, wie wir zu regionalen Vernetzungen kommen. Planerisch, auf den Stadtraum übertragen, lautet unser Ansatz: „Every district needs a market and every district needs a farm.“ Der Fokus soll stärker darauf liegen, in der Region vor Ort zu produzieren und zu verkaufen.
Gab es Erkenntnisse, die euch überrascht haben?
Das Marchfeld hat uns überrascht. Man denkt, hier würde ausschließlich lokal für die Stadtregion produziert. Tatsächlich wird hier auch Gemüse angebaut, das teilweise mit dem Flugzeug in andere Länder exportiert wird. Das ist ein negatives Beispiel.
Habt ihr eine Strategie, wie man besser informieren kann?
Ein Beispiel: In Bordeaux ist das Metropolen-Thema, das Verhältnis von Stadt, Umland und Gemeinden, institutionalisiert. Man arbeitet dort mit Grafiken und dem Bild von der Metropole. In diesem Rahmen geht es darum, wie und wen man fördern kann, etwa engagierte Akteur*innen oder die regenerative Landwirtschaft.
In Wien gibt es einen sanften Ansatz mit klimafreundlichen Betrieben. Man will zuerst Bewusstsein schaffen. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht man aber auch Vorgaben und muss Gesetze oder Limits definieren.
Im Buch geht es auch um zirkulare Strategien, Stichwort Recycling, Pfandsysteme, Kreislaufwirtschaft. Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich?
Besonders wichtig ist der Lebenszyklus von Ressourcen, etwa von Bauwerken. Die Bauwirtschaft ist ein großer Verursacher von Emissionen, und es kann nicht darum gehen, abzubrechen und neu zu bauen. Zu viel landet auf der Deponie, daher stellt sich die Frage: wie funktioniert Wiederverwertung?
Die EU-Initiative „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030“, unterstützt Städte dabei, bis Ende der Dekade klimaneutral zu werden. Gibt es Unterschiede in der Umsetzung?
Paris ist hier ein großer Vorreiter. Im ersten Schritt werden 500 von 6.000 Straßen autofrei und Fahrradwege ausgebaut. Zugleich stellt man in der Planung die Frage nach der Lebensqualität. Auch die Besteuerung von Autos hilft, Abgasraten zu reduzieren. Barcelona arbeitet schon lange an einer Metropolenregion und dem öffentlichen Nahverkehr sowie an den „Metropolitan Avenues“, also Verbindungen in der Stadtregion, die den Aktivverkehr stärken.
Man kann also, bei all den unterschiedlichen Schwerpunkten beobachten, wie sich etwas verändert.
Das kann man auch im Wiener Stadtraum wahrnehmen. Durch das Klimakonzept gibt es mehr Bäume, mehr Entsiegelung und mehr Fahrradstraßen. Um die Klimaziele zu erreichen, sind Städte besonders gefordert und Vorreiter für die Umsetzung.
Die Stadt hat großes Potenzial zu einem Ort der Klimaneutralität zu werden. Als Stadtregion ist das Potenzial noch um ein Vielfaches höher.
Stefan Mayr
CO₂-Ausstoß ist aber nicht immer gleichzusetzen mit hoher Hitzeentwicklung.
Die höhere Hitze im Stadtraum hängt auch mit dem Flächenverbrauch und der Versiegelung zusammen. Städtebauliche Maßnahmen wie die Pflanzung von Bäumen oder die Entsiegelung werden mit dem Ziel der Klimaanpassung umgesetzt und nicht um den CO₂-Ausstoß zu senken. Da müsste man die graue Energie stärker einbeziehen.
Stichwort Fleischkonsum zum Beispiel. Das betrifft die Leute nicht so, weil es nicht direkt ein Problem erzeugt, das sie im Alltag spüren.
Mit einem integrierten Ansatz kann man zeigen, dass alles miteinander zusammenhängt: Welche Ernährung man wählt, welche Produkte man verwendet, wo sie produziert werden und wie viele Menschen jeden Tag in die Stadt hinein- und herausfahren. Die Pro-Kopf-Emission ist in wenig besiedelten Gebieten viel höher als in der Stadt. Eine höhere Dichte führt zu weniger Emissionen pro Person, weil vieles mehrfach genutzt wird, wie zum Beispiel der öffentliche Verkehr, die Infrastruktur, Energie oder das Heizen.
Die Stadt hat großes Potenzial zu einem Ort der Klimaneutralität zu werden. Als Stadtregion ist das Potenzial noch um ein Vielfaches höher. Das ist deswegen so wichtig, weil Gemeindegrenzen oft die Grenzen des Einflussbereiches von Bürgermeistern sind, die unterschiedliche Ansätze verfolgen.
Was ist die effizienteste Maßnahme, die man gleich umsetzen kann?
Die Basis bildet die Mobilität. Der öffentliche Verkehr gibt ein Netz vor, das gestärkt werden muss. Dieses Netz bildet räumliche Knotenpunkte, die vielfältige Nutzungen wie Arbeitsplätze, Freizeitmöglichkeiten und Wohnen miteinander verbinden. Diese Knotenpunkte sollten verstärkt mit Fahrradwegen und intelligenten Mobilitätskonzepten und Sharing Angeboten verbunden werden. Das ist die Idee des angesprochenen 15-Minuten-Territoriums.
Das Ziel sind Kreisläufe, die sich schließen, auch in Bezug auf Ressourcen wie Wasser, Abfall oder Lebensmittel. So schafft man einen großen Schritt in Richtung weniger Emissionen und mehr Nachhaltigkeit.
Vielen Dank für das Gespräch!
Stefan Mayr

Stefan Mayr ist Architekt und Urbanist sowie Mitgründer des Wiener Büros Superwien Urbanism. In seiner Arbeit verbindet er Stadtplanung mit gesellschaftlicher Verantwortung – von nachhaltiger Architektur über partizipative Stadtentwicklung bis hin zu internationalen Forschungsprojekten.
Als Mitinitiator der Forschungskooperation MetroLab engagiert er sich für die Dekarbonisierung von Stadtregionen. Gemeinsam mit internationalen Partnern entwickelt er Strategien, wie urbane Räume lebenswerter und klimafreundlicher gestaltet werden können.
Buchtipp
Mapping the Zero Carbon City Region: Vienna Metropolitan Area
Hrsg. von Roland Krebs, Stefan Mayr, Cédric Ramière und Claudia Staubmann
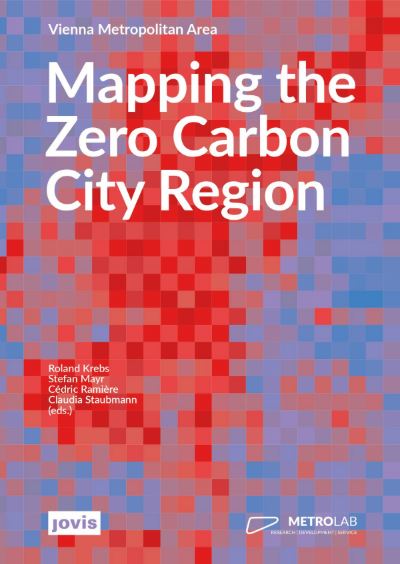
Das Buch präsentiert eine innovative kartografische Methode zur Darstellung und Analyse klimarelevanter Entwicklungen in Stadtregionen. Anhand der Wiener Metropolregion zeigt es, wie urbane Räume mithilfe von Karten, Daten und Designstrategien in Richtung Klimaneutralität transformiert werden können. Ein praktisches Handbuch für alle, die an der Schnittstelle von Stadtplanung, Architektur und Klimapolitik arbeiten.




