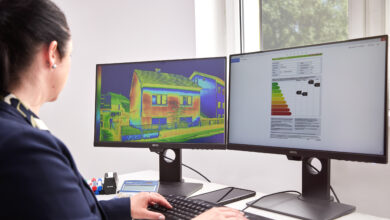„Wir wissen, was zu tun ist – wir müssen es nur tun“
Der Klimaschutz steht politisch unter Druck, doch die Bauwirtschaft bleibt einer der größten Hebel für echte Veränderung. Der Architekt und Ingenieur Werner Sobek erklärt im Interview, warum klare Emissionsziele, technische Offenheit und gesellschaftlicher Dialog entscheidend sind – und weshalb wir mehr Zuversicht wagen sollten.
Der Bau- und Architektursektor steht vor gewaltigen Umbrüchen: Klimaziele, Emissionsvorgaben, Energiewende – aber auch gesellschaftliche Polarisierung und politische Blockaden. Wie gehen wir damit um? Und wie kann die Bauwirtschaft ihrer Verantwortung gerecht werden?
Vor ziemlich genau einem Jahr war Prof. Werner Sobek schon einmal zu Gast im Architektur- und Bauforum. Damals sprach der Architekt und Nachhaltigkeitsexperte über Emissionen im Bausektor, Wärmepumpen, den Reformbedarf in der Gesetzgebung – und über seine Hoffnung auf eine neue Baukultur. Ein Jahr später hat sich viel verändert – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Wie steht heute es um die Klimatransformation in Architektur und Bauwesen?
Stefan Böck: Wie bewerten Sie die Entwicklungen des vergangenen Jahres? Was hat Sie am meisten bewegt – beruflich wie gesellschaftlich?

Werner Sobek: Ich beobachte mit Sorge, dass der gesellschaftliche Diskurs über Nachhaltigkeit fast verstummt ist. Stattdessen dominieren Themen wie Wirtschaftskrisen und geopolitische Konflikte – oft begleitet von einem politischen Rechtsruck. In Deutschland werden viele umweltpolitische Ziele kaum noch diskutiert – oder stillschweigend relativiert. Ein besonders deutliches Beispiel hierfür ist das Verbrennerverbot. Es wurde schon vor längerem vereinbart, dass ab 2035 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Doch nun erleben wir eine 180-Grad-Wende – mit dem Argument, der Wohlstand müsse gesichert werden. Das zeigt: Der Schutz der Umwelt tritt schnell zurück hinter wirtschaftliche Interessen.
Wie bewerten Sie die Diskussion rund um die Wärmepumpe – auch als Symbol für die Wärmewende?
Vieles läuft falsch. Es gibt massive Fehlanreize im Markt. Eine Wärmepumpe kostet in Deutschland rund 4.000 bis 5.000 Euro mehr als in Frankreich – für das gleiche Modell. Warum? Weil der Markt durch staatliche Zuschüsse verzerrt ist. Hinzu kommt der Strompreis. Technisch ist die Wärmepumpe effizient – sie produziert aus einer Kilowattstunde Strom im Durchschnitt 3,5 Kilowattstunden Wärme. Aber wenn der Strom drei- bis viermal teurer ist als Gas, verpufft dieser Vorteil wirtschaftlich. Der Staat müsste dringend die Wettbewerbsfähigkeit elektrischen Heizens gegenüber fossilen Brennstoffen verbessern. Und zwar strukturell – über Steuern, Netzentgelte und ein kluges Preissystem.
Sie haben im vergangenen Jahr betont, dass wir kein Energieproblem haben – sondern ein Emissionsproblem. Wie sehen Sie das heute?
Ich würde das noch präzisieren: Wir haben ein Energieträgerproblem. An Energie mangelt es global nicht – allein die Sonne liefert das Zehntausendfache dessen, was wir brauchen. Aber wir haben die Infrastruktur nicht, um diese Energie zu erschließen und zu nutzen. Die Stromnetze sind nicht flächendeckend und in hinreichender Leistungsfähigkeit vorhanden. Deshalb ist auch die Förderung der Elektromobilität abrupt eingestellt worden: Es fehlt schlicht die Netzkapazität, um das neue System zu tragen.
Klare, verbindliche Zielvorgaben sind der richtige Weg. Der Weg zum Ziel muss offen bleiben – so fördern wir Innovation.
Werner Sobek
Kommen wir zum Bauwesen. Oft heißt es, dieser Sektor sei für ein Drittel der weltweiten Emissionen verantwortlich. Stimmt das?
Nein – das ist zu kurz gegriffen. Der tatsächliche Anteil liegt bei rund 53 Prozent. Denn meist werden nur die Emissionen während der Gebäudenutzung berücksichtigt – also Heizen, Kühlen, Warmwasser. Nicht eingerechnet sind Infrastrukturprojekte, der Bauprozess selbst und die grauen Emissionen – also Emissionen, die bei der Herstellung, beim Transport sowie beim Ein- und Ausbau von Baumaterialien entstehen. Diese sind schwer zu erfassen, wurden daher lange ignoriert – aber sie machen einen erheblichen Teil am Ganzen aus.
Was wäre nötig, um die Bauwirtschaft auf einen klimaverträglichen Pfad zu bringen?
Ein Paradigmenwechsel. Nicht: „Du musst bessere Fenster einbauen“ – sondern: „Du darfst pro Person nur eine bestimmte Menge CO₂ ausstoßen.“ Klare, verbindliche Zielvorgaben sind der richtige Weg. Der Weg zum Ziel muss offen bleiben – so fördern wir Innovation. Ein Vorbild ist das Pariser Klimaabkommen: Es macht eine Zielvorgabe. Von aktuell rund 50 Milliarden Tonnen CO₂ weltweit müssen wir bis 2045 auf fünf Milliarden kommen. Wir müssen uns dabei entlang eines Emissionsreduktionspfades bewegen. Diesen Pfad müssen alle Sektoren einhalten – auch die Bauwirtschaft.
Wie ordnen Sie das Manifest ein, das Sie gemeinsam mit anderen im November 2024 veröffentlicht haben? Was war hierbei Ihr Ziel?
Das Manifest ist ein Appell an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, endlich die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir wollten bewusst weg vom eindimensionalen Denken in Energieeffizienzklassen oder Dämmstärken – hin zu einem ganzheitlichen Verständnis von Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das Manifest formuliert fünf zentrale Punkte: klare Emissionsziele statt Katalogen von Maßnahmen zur Erreichung baulicher Energieeffizienz, Förderung innovativer Speichertechnologien, ein sozial gerechtes Energiesystem, Entbürokratisierung und eine neue Kultur des Miteinanders. Im Kern geht es um Verantwortung: Wir wissen längst, was technisch und ökologisch nötig ist – wir müssen es nur endlich umsetzen.
Architektinnen und Architekten sollten nicht nur bauen – sondern auch Diskurse moderieren. Sie können zwischen Politik, Bevölkerung, Technik und Gestaltung vermitteln.
Werner Sobek
Was fordern Sie vom Gesetzgeber?
Deregulierung und Simplifizierung. Aber nicht im Sinne von „weniger Klimaschutz“, sondern im Sinne von mehr Klarheit. Anstelle eines 89-seitigen Gebäudeenergiegesetzes genügt ein einziger Satz: „Die klimaschädlichen Emissionen beim Herstellen, Betreiben, Um- und Rückbauen von Bauwerken müssen einem klar definierten Reduktionspfad folgen.“ Diese Art der Regulierung wird auch mit dem EU-System ETS2 kommen – über einen Zertifikatehandel. Zusätzlich müssen die Verbraucher beim Strompreis entlastet werden, damit Heizen und Kühlen mit Strom auch wirtschaftlich attraktiv wird.
Viele halten klimaneutrales Bauen für unbezahlbar. Stimmt das?
Nein – das ist ein Mythos. Unsere Häuser wurden bisher ja auch warm – allerdings hauptsächlich mit Öl und Gas. Wenn wir stattdessen Strom verwenden, z. B. über Wärmepumpen, und der Strom nur wenig mehr als Gas kostet, dann haben wir im elektrischen Betrieb von Gebäuden eine interessante Kostensituation. Kombiniert man moderne Speicherlösungen mit Photovoltaik auf dem Dach, entlang von Straßen und an Schienenstrecken, dann erhält man wirtschaftlich tragfähige Lösungen.
Welche Rolle spielt die Architektenschaft in diesem Wandel?
Eine entscheidende. Architektinnen und Architekten sind interdisziplinär ausgebildet. Sie können technische, gesellschaftliche und gestalterische Aspekte verbinden. Deshalb sollten sie nicht nur bauen – sondern auch Diskurse moderieren. Sie können zwischen Politik, Bevölkerung, Technik und Gestaltung vermitteln. Und sie können helfen, aus Wissen Handlung zu machen.
Lassen Sie uns zum Schluss nach vorne schauen. Was ist Ihr optimistischer Ausblick?
Ich bin überzeugt: Wir können das schaffen. Vier einfache Ziele: Emissionen senken – mit klaren Vorgaben, ohne Detailzwang. Natur schützen – Boden, Wasser, Artenvielfalt. Energieträger wechseln – nicht weniger Energie, sondern saubere Energie. Und viertens – ganz wichtig: miteinander reden. Nicht gegeneinander, nicht resigniert, sondern mit Hoffnung, Lust und Gemeinsinn.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das komplette Gespräch als Podcast hören!Zur Person
Prof. Dr. Werner Sobek (*1953) ist Architekt und Bauingenieur. Er gründete das international tätige Planungsbüro Werner Sobek AG und leitete bis 2020 das von ihm gegründete Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) an der Universität Stuttgart – eine weltweit anerkannte Forschungseinrichtung für ressourcenschonendes Bauen. 2024 initiierte er das Manifest für eine neue Klimapolitik im Gebäudesektor.