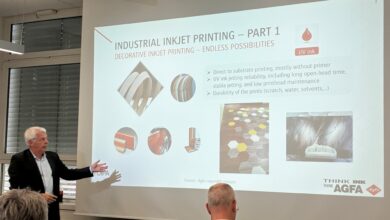Normen als Sicherheitsgurt
Sind geltende Trinkwasser-Hygienestandards in der Praxis finanziell noch realistisch? Das war einer der Fragen, mit denen sich eine hochkarätig besetzte Expertenrunde beim „Talk am See“ der Gebäude Installation beschäftigte.

Jörg Wiesbauer erinnert sich noch gut an eine Erfahrung, die er als junger Installateur gemacht hat: Er musste damals in einem Bürogebäude ein Hock-WC aus Italien einbauen. Das Problem: Das Designerstück war zwar äußerst formschön, besaß aber keinen integrierten Siphon. „Ich habe dem Architekten gesagt, dass wir eine Stufe einbauen müssen, um einen Geruchsverschluss einbauen zu können. Seine Antwort werde ich nie vergessen: ‚Das geht nicht. Dann kann die Energie nicht mehr durch das Gebäude fließen.‘ Ich habe daraufhin schriftlich festgehalten, dass jeder Entwässerungsgegenstand einen Geruchsverschluss braucht, und dabei auf die entsprechende Norm verwiesen. Das hat er unterschrieben.“ Bei der Übergabe des Gebäudes sollte sich diese Vorsichtsmaßnahme bewähren: „Es stank bestialisch. Der Architekt sagte zu mir: ‚Herr Wiesbauer, Sie sind Meister Ihres Gewerkes. Sie sind verantwortlich.‘ Ich habe ihm das Schreiben gezeigt. Damit war ich abgesichert.“
Talk am Attersee

Wiesbauer, heute Seminarleiter beim Systemhersteller Viega in Österreich, erzählte diese Geschichte, während seiner Key Note beim „Talk am See“, den die Gebäude Installation am 6. November in der Österreich-Zentrale von Viega am Attersee veranstaltete. Die hochkarätig besetzte Panel-Diskussion stand unter dem Titel „Zwischen Sparzwang und strengen Normen“. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Viega Österreich-Geschäftsführer Christian Rüsche als Hausherr.
Die Idee hinter der Diskussion: Die Sicherstellung hygienisch einwandfreien Trinkwassers gehört zu den wesentlichen Herausforderungen der Gebäudetechnik – besonders bei der Sanierung von Altbauten. Steigende Kosten, strenge Normen und knappe Budgets bringen Installateure und Planer aber zunehmend an wirtschaftliche Grenzen. Der „Talk am See“ widmete sich daher brennenden Fragen rund um die Thematik: Sind geltende Trinkwasser-Hygienestandards in der Praxis finanziell noch realistisch? Welche Innovationen ermöglichen Hygienesicherheit zu vertretbaren Kosten? Sind Anpassungen bei Normen nötig, um realitätsnah und sicher zu sanieren?
„Ja. Normen nerven manchmal gewaltig. Aber was nervt mehr. Wenn man Trinkwasser abkochen muss, weil Keime im Netz sind oder wenn man sich bei der Installation an bestimmte Vorgaben hält?“, lautete die Antwort von Viega-Seminarleiter Wiesbauer. „Normen sind keine Schikanen, sondern erleichtern den Alltag. Stellen Sie sich vor, jeder hätte eine eigene Vorstellung, wie eine hygienische Trinkwasserinstallation auszusehen hat – das würde nicht funktionieren. Normen sind ein Sicherheitsgurt.“
Wiesbauer war einer der Experten, die an der von Gebäude Installation-Chefredakteur Martin Hehemann moderierten Diskussion teilnahmen. Die Runde wurde durch drei weitere komplettiert durch: Thomas Luksch, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und stellvertretende Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in Oberösterreich, Helmut Richter, Experte im Bereich Trinkwasser und Materialprüfung an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt (TGM) in Wien, sowie Arno Sorger, Geschäftsführer, des Unternehmen WHU, das auf mikrobiologische und chemische Analysen spezialisiert ist.
Auf Facebook kann man das Video der Veranstaltung ansehenHervorragendes Werkzeug

Mit-Diskutant Luksch ergänzte das Statement von Viega-Mann Wiesbauer: „Aus Sicht des Sachverständigen sind Normen ein hervorragendes Werkzeug. Wenn ich zu einem Schaden gerufen werde, sehe ich oft sofort, wo das Problem liegt – und finde die passende Normenpassage, um den Fehler zu belegen“, erklärte Luksch. Er gab jedoch zu bedenken: „Für Installateure ist das deutlich komplexer. Sie müssen nicht nur Trinkwassernormen beachten, sondern auch Vorgaben für Gas, Wasser, Heizung, Lüftung, Isolierung – eine regelrechte Sintflut an Vorgaben.“ In der Podiumsdiskussion verwies er auf zwei dicke Papierstapel, die er mitgebracht hatte: die ÖNORM B 2531 und B 1921 – jeweils rund 60 Seiten stark. „Und das sind nur Beispiele. Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen, Normen, Richtlinien und Herstellervorgaben, die wir Installateure einhalten müssen“, so Luksch.
„Wir haben nationale Normen, europäische EN-Normen und ISO-Normen. Bestehen sie parallel, wird es kompliziert. Im Ernstfall ist der Einzelne gezwungen, sich im Vorhinein Gedanken zu machen: Wie erfülle ich die Vorgaben?“, stimmte TGM-Fachmann Richter zu. „Gleichzeitig liegt darin aber auch eine Chance: Wer seine Mitarbeitenden qualifiziert – mit gezielten Schulungen – hebt sich von der Masse ab. Wir kommen an Normen nicht vorbei“, lautete seine Einschätzung. „Die Frage ist eher: Wie schaffen wir es, gemeinsam wieder etwas Ordnung in das Ganze zu bringen?“
Oder: Ist das überhaupt möglich? Ja, lautete die Antwort von WHU-Geschäftsführer Sorger. „Normen werden nicht irgendwo im Elfenbeinturm beschlossen. In Österreich gilt der Grundsatz, dass alle interessierten Kreise mitarbeiten können – praktisch und nicht nur theoretisch. Man muss sich nur bewerben und sagen: Ich will da mitarbeiten“, so Sorger weiter. Das betonte auch Richter: „In Österreich kann jede und jeder über den Austrian Standards Server die Normenentwürfe einsehen und Kommentare dazu abgeben. Diese Kommentare müssen in den Ausschüssen bearbeitet werden“, meinte der TGM-Experte. „Ja, das ist Arbeit. Aber es ist auch eine Einladung an die Fachwelt, sich einzubringen. Die Möglichkeit dazu besteht – für alle, und jede Stimme zählt gleich.“
Sicherheit durch Normen

Sorger erläuterte die Normenarbeit an einem Beispiel: Früher habe es keine Regelungen zu Legionellen gegeben. Dann sei die ÖNORM B 5019 entstanden – laut Sorger eine Pioniernorm in Europa, „die erstmals ganz klar definierte, wie ein System betrieben werden muss, damit keine Legionellen entstehen. Diese Norm wurde sehr gut angenommen“. Dann kamen, so Sorger weiter, die Auswüchse. „Die einen sagten: Man muss möglichst viel prüfen. Die anderen: Wenn nur eine Legionelle gefunden wird, sofort desinfizieren! Wieder andere: Einfach Chlor rein, dann passiert nichts mehr.“ All das habe zu Überreaktionen geführt. „Also setzte man sich wieder zusammen und entwickelte ein intelligenteres Konzept – mit Blick auf das Ganze, nicht nur auf Einzelmaßnahmen.“ Das Ergebnis: die ÖNORM B 1921. „Interessanterweise ist der Aufwand dort geringer, aber: Die Norm ist komplexer und daher schwerer zu verstehen. Für Laien wirkt sie wie ein undurchschaubares Werk. Wer sie aber verstanden hat, erkennt: Das ist richtig gut“, meinte Sorger. Sein Fazit: „Man muss sich mit der Thematik beschäftigen. Wenn ich heute einen Installateur beauftrage, erwarte ich nicht nur handwerkliches Können – sondern auch, dass er sich mit der Problematik auskennt.“
Und, da war sich die Runde einig, das geht nur mit Schulung. „Ein zentraler Punkt ist die Schulung“, betonte Innungsvertreter Luksch. „Viele Hersteller und Ausbildungszentren bieten Weiterbildungen an, aber das kostet Betrieben Zeit und Geld. Und es reicht nicht, wenn nur der Unternehmer geschult ist – auf der Baustelle arbeitet meist der Monteur, nicht der Chef, außer bei kleinen Betrieben.“ Seine Einschätzung zum Schulungsbedarf: „Fünf Tage pro Jahr und pro Mitarbeiter*in. Das ist enorm, aber ohne geht es nicht.“
Viega-Seminarleiter Wiesbauer sieht das ähnlich: „Schulungen kosten Zeit und Geld. Aber sie geben Sicherheit – und verhindern Fehler“, meint er. „Ich erlebe es oft: Wenn Mitarbeiter*innen nicht geschult sind, entstehen Probleme. Dann kommt oftmals das große Aha. In der Schulung kommt das Aha vorher. Und das ist gut so.“